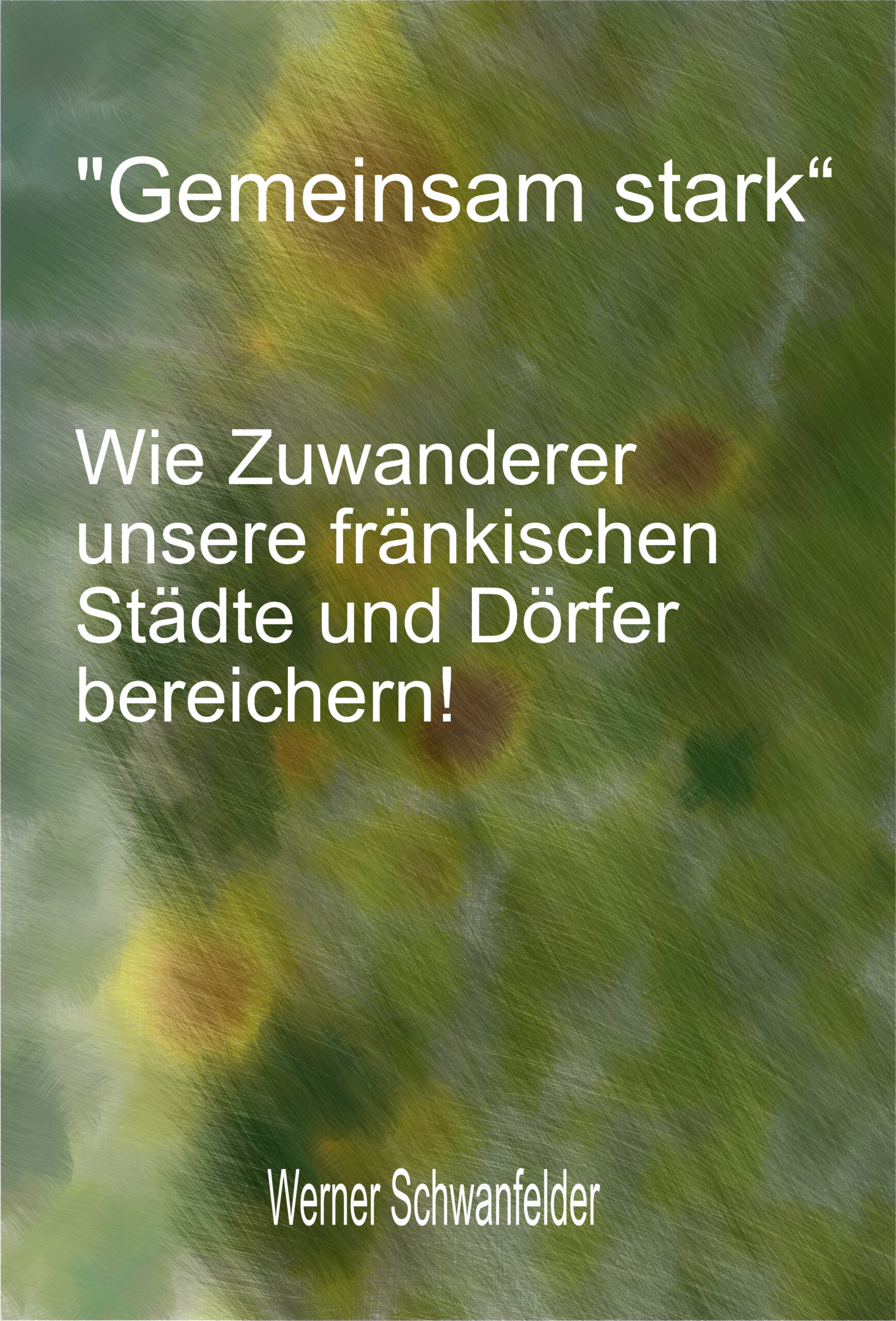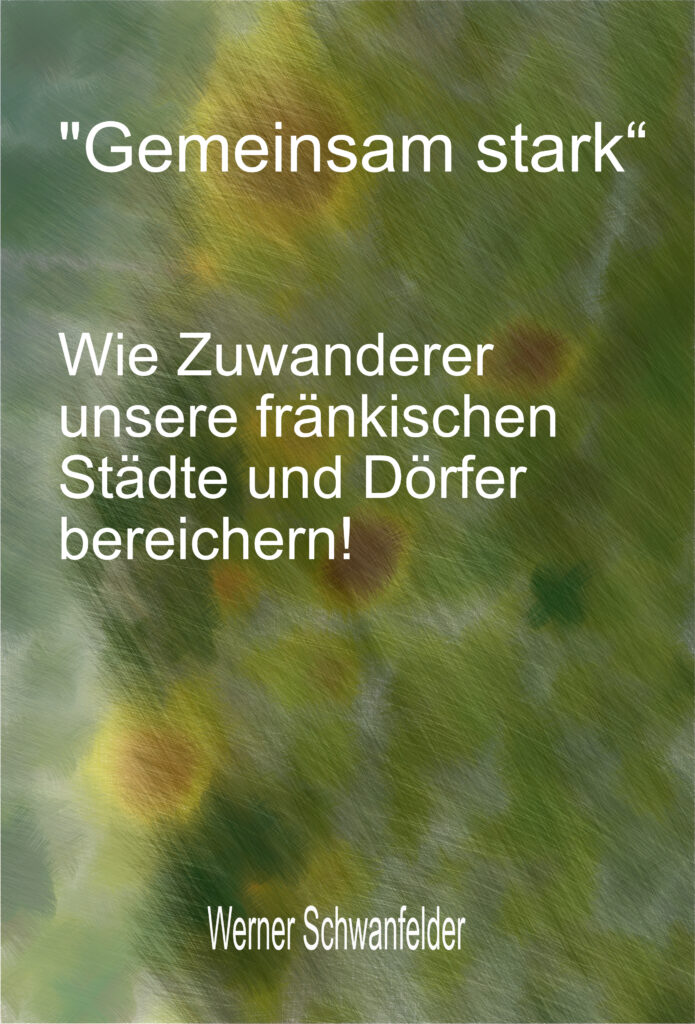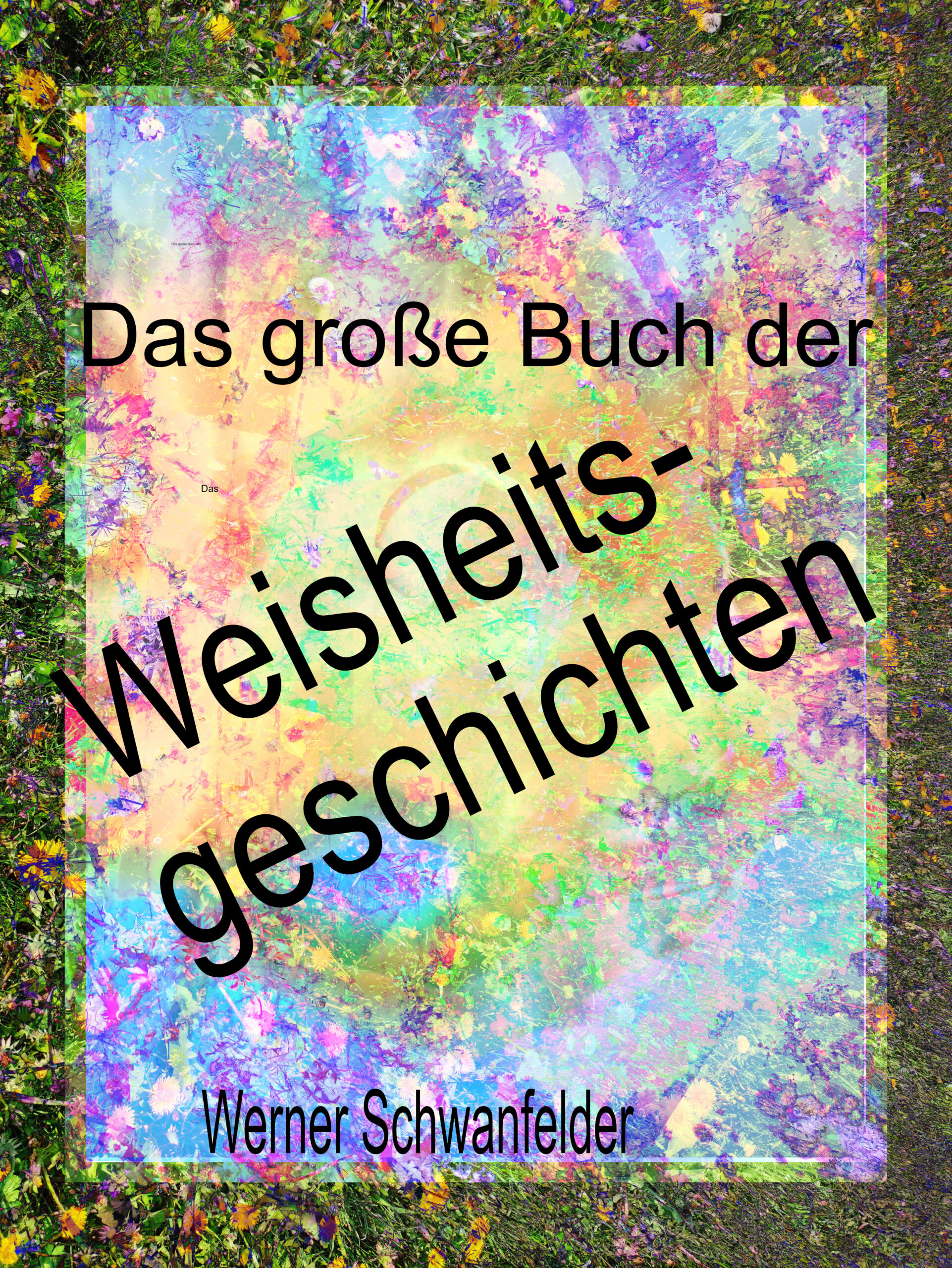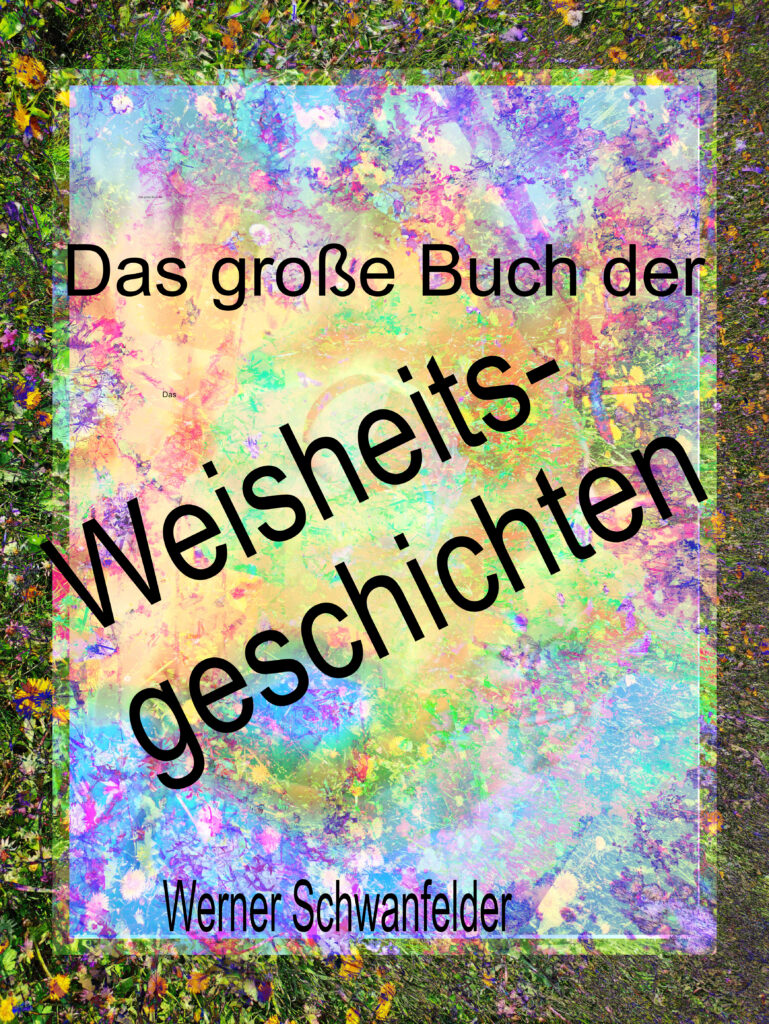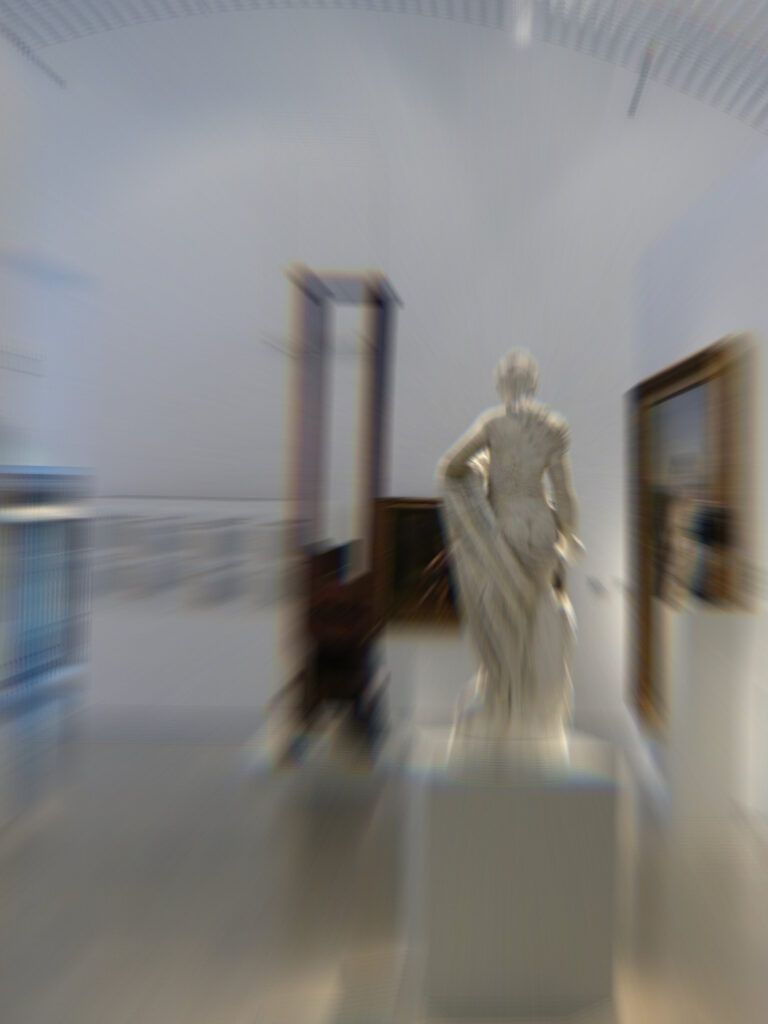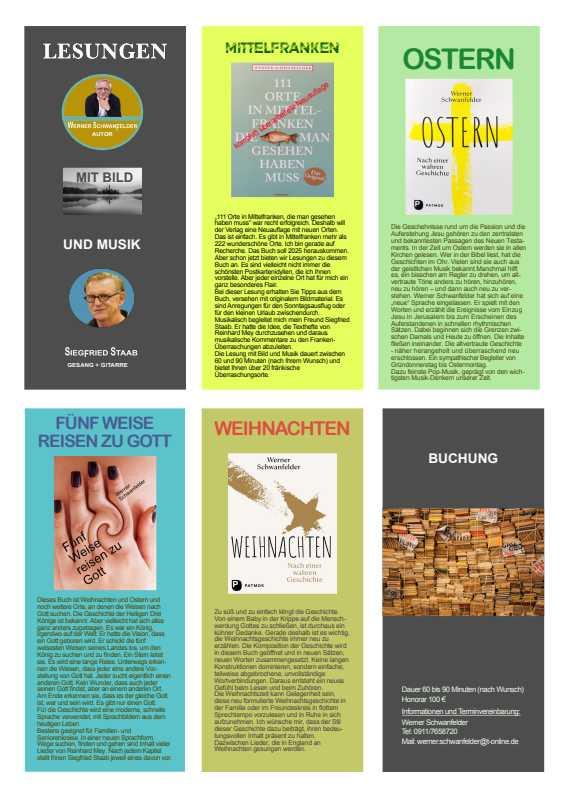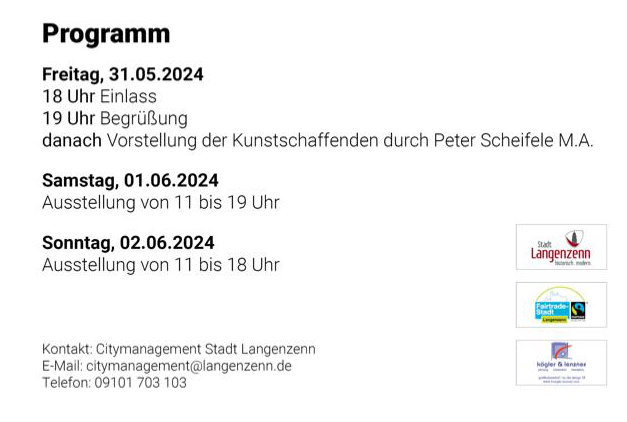Auf den Pfaden der Stille

Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr wird „still“ genannt. Wenn ich an den Weihnachtstagen durch die Stadt laufe, wirkt sie tatsächlich wie in Watte gepackt. Die Läden sind geschlossen, nur wenige Spaziergänger sind auf den Straßen. Die Sonne heißt uns am Morgen willkommen, in aller Stille. Ich bilde mir ein, sie zu spüren. Ich bin auf der Suche nach meiner Stille.
Hörst Du die Stille? Die Stille am Grab ist eine andere als die nach dem Feuerwerk. Die Stille auf den Fluren eines Altenheims ist eine andere als die in einer Kirche. Die Stille, in der man das Gras wachsen hört, ist eine andere als die nach einer Stunde Kraftsport. Die Stille bei einer Klausuraufsicht ist eine andere als die beim Aufstieg auf den Berggipfel. Die Stille im Bunker von Odessa, in dem die Menschen auf den nächsten Raketeneinschlag warten, ist eine andere als die am Bettchen des schlafenden Kindes. Es gibt eine tödliche Stille und eine schöpferische; es gibt eine lähmende, eine bedrohliche, eine unerträgliche Stille – die Stille vor einem Gewitter zum Beispiel, die sich dann mit Blitz und Donner entlädt. Und es gibt eine beruhigende Stille, in der man seinen eigenen Atem und seine innere Stimme hört, bestärkend und verbindend. Es gibt eine Musik der Stille: den rauschenden Regen, den heulenden Wind, den Schlag einer Turmuhr.
Die Stille nach einem Konzert ist eine andere als die vor einem Konzert. Manchmal stört mich der Applaus, weil er die Stille zerstört. Ist aber bloße Geräuschlosigkeit Stille? Ist Schweigen Stille? Es gibt das Einverständnis-Schweigen, das „Wir-müssen-nicht-dauernd-reden“-Schweigen; es gibt ein Wohlgefühl im Dasein und im Stillsein. Es gibt das beredte Schweigen, das Schweigen, das mehr sagt als tausend Worte und das Zustimmung, Ablehnung, Verlegenheit oder Scham ausdrücken kann. Es gibt auch das verbissene Schweigen, die Sprachlosigkeit, das ätzende Schweigen nach dem Streit unterm Christbaum, das kampfbereite und zersetzende Schweigen nach verbalen Angriffen, das Schweigen, wenn jemand mundtot gemacht wird.
Das aggressive Schweigen ist keine Stille. Vielleicht kommt die Stille, wenn die Nerven sich wieder beruhigen, wenn etwas Trauriges und Ohnmächtiges wächst – ein Gefühl, mit dem eine achselzuckende Art von Gelassenheit einhergeht. Dann kann die Stille der Friedensschluss sein mit dem, was gerade ist – und zugleich ein Kraftschöpfen, um wieder an die Möglichkeit der Veränderung zu glauben.
Ich verordnete mir Stille, wenn ich schreibe, wenn ich denke, wenn ich erschaffe. Die Schöpfung kann nur aus der Stille entstehen. Manchmal hoffe ich jedoch auch, dass das Telefon meine Stille stört, liebevolle Worte an mein Ohr dringen. Dass mich jemand besucht und meine Stille zerstört. Viel zu häufig lasse ich Fernsehen und Radio meine Stille verletzen. Sie reißen mich in die Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Ich muss mir die Stille zurückerobern.
Eine Seele ohne Stille ist wie eine Stadt ohne Schutz. Stille ist kein physikalischer oder physischer Zustand, sondern vor allem ein psychischer. Stille ist innere Ruhe; sie ist ein seelischer Vorgang. Kreativität braucht diese Stille. Auch die Gesellschaft braucht Stille – jedenfalls ab und zu. Manchmal erlebe ich, dass sich die Kommunikation beschleunigt, aber die Gesellschaft, die Weltgemeinschaft, kommt nicht vom Fleck – nicht politisch, nicht gesellschaftlich, nicht sozial. Dann entflieht mir die Stille und das Leben schreit mich an. Ein rasender Stillstand beschreibt unsere heutige Gesellschaft. Viel zu viele Neuigkeiten sind auf viel zu vielen Kanälen verfügbar.
In diesen sogenannten stillen Tagen bin ich auf der Suche nach einer Stille, die mir für das nächste Jahr Kraft gibt. Diese Stille ist eine Kraft des Geistes, die sich jenseits des Materiellen befindet. Ich höre die Stille. Sie ist ausdrucksstark.
Eigentlich müsste ich so manches Weihnachtslied von Herzen lieben. Wenn berichtet wird von der stillen, heiligen Nacht, vom leise rieselnden Schnee, möchte meine Stille schreien. In der weihnachtlichen Geschichte von Krippe und Esel, von Hütten und Engeln, fehlt das Kind. Es drängt sich ein Heldenkrieger in den Vordergrund. Er heißt Elias und stammt aus dem Alten Testament. Er habe Hunderte Götzendiener mit dem Schwert getötet, wird erzählt: für Gott, für die höhere Sache, für Wahrheit und Gerechtigkeit, natürlich. Dieser Elias geht kaputt an seinem Wahn. Er ist eine gebrochene Existenz, des Mordens müde und des eigenen Lebens überdrüssig, an allem zweifelnd und an sich selbst, verzweifelnd. In dieser Situation beschließt Gott, sich dem Elias zu zeigen. Es kommt ein brausender Sturm, aber darin ist er nicht. Es kommt ein gewaltiges Beben, aber darin ist er auch nicht. Es kommt ein verzehrendes Feuer, aber auch darin ist er nicht. Aber nach dem Feuer kommt die Stille. In ihr ist Gott. Und vermutlich auch die Wahrheit. Elia hat verstanden. Ich weiß nicht, was uns die Geschichte sagen soll. Werden einmal auch Putin und Trump die Stille und damit den Frieden entdecken? Trump empfindet sich wohl als Statthalter Gottes. Ob er in Stille mit ihm kommuniziert? Elia jedenfalls wurde nicht begraben, sondern in einem Feuerwagen lebend in den Himmel entrückt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies in Stille geschah.
Schließlich stelle ich mir die wahrlich echten Weihnachtsfragen: Wo ist in den Stürmen, Beben und Feuern unserer Zeit die kreative und verbindende Stille? Wo sind die leisen Wahrheiten? Um sie finden zu können, tut es Not, selbst still zu werden – wenigstens manchmal. Das ist ganz leicht und zugleich ganz schön schwer. Ich muss jetzt meine Stille unterbrechen, denn meine beiden Vögel lärmen. Sie fordern neues Futter und neues Wasser.
Werner Schwanfelder