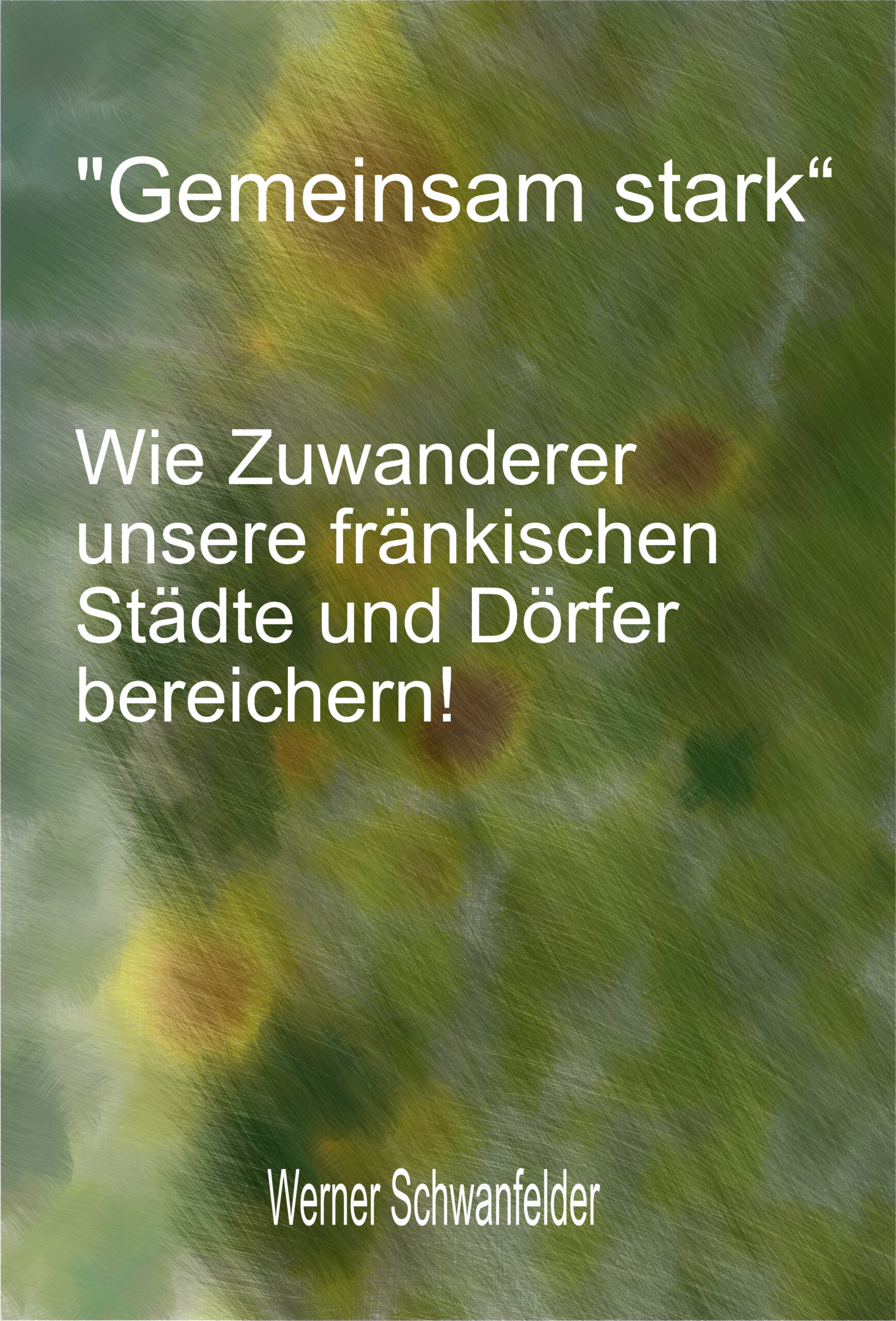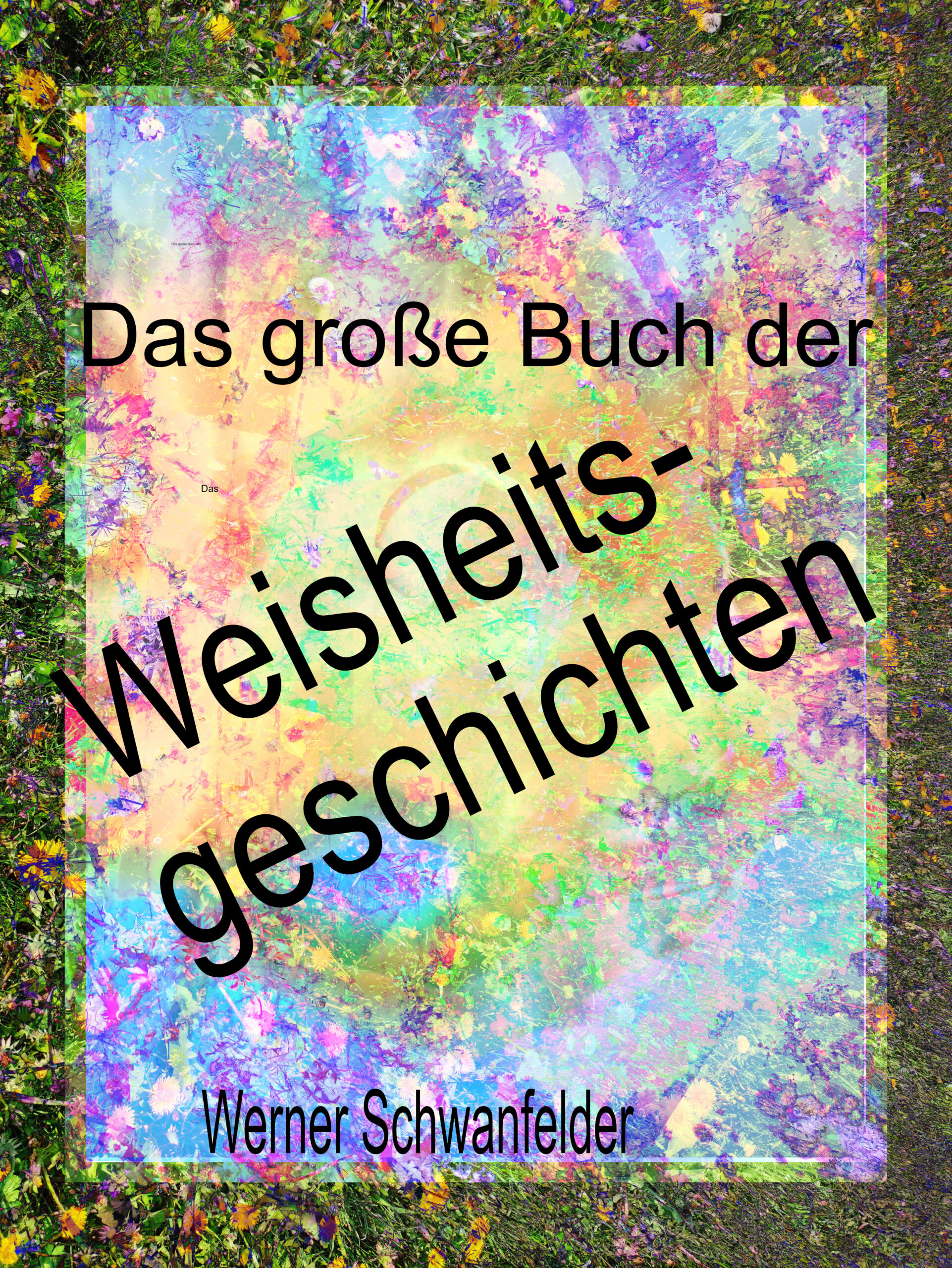Auf den Pfaden der Stille
Auf den Pfaden der Stille

Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr wird „still“ genannt. Wenn ich an den Weihnachtstagen durch die Stadt laufe, wirkt sie tatsächlich wie in Watte gepackt. Die Läden sind geschlossen, nur wenige Spaziergänger sind auf den Straßen. Die Sonne heißt uns am Morgen willkommen, in aller Stille. Ich bilde mir ein, sie zu spüren. Ich bin auf der Suche nach meiner Stille.
Hörst Du die Stille? Die Stille am Grab ist eine andere als die nach dem Feuerwerk. Die Stille auf den Fluren eines Altenheims ist eine andere als die in einer Kirche. Die Stille, in der man das Gras wachsen hört, ist eine andere als die nach einer Stunde Kraftsport. Die Stille bei einer Klausuraufsicht ist eine andere als die beim Aufstieg auf den Berggipfel. Die Stille im Bunker von Odessa, in dem die Menschen auf den nächsten Raketeneinschlag warten, ist eine andere als die am Bettchen des schlafenden Kindes. Es gibt eine tödliche Stille und eine schöpferische; es gibt eine lähmende, eine bedrohliche, eine unerträgliche Stille – die Stille vor einem Gewitter zum Beispiel, die sich dann mit Blitz und Donner entlädt. Und es gibt eine beruhigende Stille, in der man seinen eigenen Atem und seine innere Stimme hört, bestärkend und verbindend. Es gibt eine Musik der Stille: den rauschenden Regen, den heulenden Wind, den Schlag einer Turmuhr.
Die Stille nach einem Konzert ist eine andere als die vor einem Konzert. Manchmal stört mich der Applaus, weil er die Stille zerstört. Ist aber bloße Geräuschlosigkeit Stille? Ist Schweigen Stille? Es gibt das Einverständnis-Schweigen, das „Wir-müssen-nicht-dauernd-reden“-Schweigen; es gibt ein Wohlgefühl im Dasein und im Stillsein. Es gibt das beredte Schweigen, das Schweigen, das mehr sagt als tausend Worte und das Zustimmung, Ablehnung, Verlegenheit oder Scham ausdrücken kann. Es gibt auch das verbissene Schweigen, die Sprachlosigkeit, das ätzende Schweigen nach dem Streit unterm Christbaum, das kampfbereite und zersetzende Schweigen nach verbalen Angriffen, das Schweigen, wenn jemand mundtot gemacht wird.
Das aggressive Schweigen ist keine Stille. Vielleicht kommt die Stille, wenn die Nerven sich wieder beruhigen, wenn etwas Trauriges und Ohnmächtiges wächst – ein Gefühl, mit dem eine achselzuckende Art von Gelassenheit einhergeht. Dann kann die Stille der Friedensschluss sein mit dem, was gerade ist – und zugleich ein Kraftschöpfen, um wieder an die Möglichkeit der Veränderung zu glauben.
Ich verordnete mir Stille, wenn ich schreibe, wenn ich denke, wenn ich erschaffe. Die Schöpfung kann nur aus der Stille entstehen. Manchmal hoffe ich jedoch auch, dass das Telefon meine Stille stört, liebevolle Worte an mein Ohr dringen. Dass mich jemand besucht und meine Stille zerstört. Viel zu häufig lasse ich Fernsehen und Radio meine Stille verletzen. Sie reißen mich in die Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Ich muss mir die Stille zurückerobern.
Eine Seele ohne Stille ist wie eine Stadt ohne Schutz. Stille ist kein physikalischer oder physischer Zustand, sondern vor allem ein psychischer. Stille ist innere Ruhe; sie ist ein seelischer Vorgang. Kreativität braucht diese Stille. Auch die Gesellschaft braucht Stille – jedenfalls ab und zu. Manchmal erlebe ich, dass sich die Kommunikation beschleunigt, aber die Gesellschaft, die Weltgemeinschaft, kommt nicht vom Fleck – nicht politisch, nicht gesellschaftlich, nicht sozial. Dann entflieht mir die Stille und das Leben schreit mich an. Ein rasender Stillstand beschreibt unsere heutige Gesellschaft. Viel zu viele Neuigkeiten sind auf viel zu vielen Kanälen verfügbar.
In diesen sogenannten stillen Tagen bin ich auf der Suche nach einer Stille, die mir für das nächste Jahr Kraft gibt. Diese Stille ist eine Kraft des Geistes, die sich jenseits des Materiellen befindet. Ich höre die Stille. Sie ist ausdrucksstark.
Eigentlich müsste ich so manches Weihnachtslied von Herzen lieben. Wenn berichtet wird von der stillen, heiligen Nacht, vom leise rieselnden Schnee, möchte meine Stille schreien. In der weihnachtlichen Geschichte von Krippe und Esel, von Hütten und Engeln, fehlt das Kind. Es drängt sich ein Heldenkrieger in den Vordergrund. Er heißt Elias und stammt aus dem Alten Testament. Er habe Hunderte Götzendiener mit dem Schwert getötet, wird erzählt: für Gott, für die höhere Sache, für Wahrheit und Gerechtigkeit, natürlich. Dieser Elias geht kaputt an seinem Wahn. Er ist eine gebrochene Existenz, des Mordens müde und des eigenen Lebens überdrüssig, an allem zweifelnd und an sich selbst, verzweifelnd. In dieser Situation beschließt Gott, sich dem Elias zu zeigen. Es kommt ein brausender Sturm, aber darin ist er nicht. Es kommt ein gewaltiges Beben, aber darin ist er auch nicht. Es kommt ein verzehrendes Feuer, aber auch darin ist er nicht. Aber nach dem Feuer kommt die Stille. In ihr ist Gott. Und vermutlich auch die Wahrheit. Elia hat verstanden. Ich weiß nicht, was uns die Geschichte sagen soll. Werden einmal auch Putin und Trump die Stille und damit den Frieden entdecken? Trump empfindet sich wohl als Statthalter Gottes. Ob er in Stille mit ihm kommuniziert? Elia jedenfalls wurde nicht begraben, sondern in einem Feuerwagen lebend in den Himmel entrückt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies in Stille geschah.
Schließlich stelle ich mir die wahrlich echten Weihnachtsfragen: Wo ist in den Stürmen, Beben und Feuern unserer Zeit die kreative und verbindende Stille? Wo sind die leisen Wahrheiten? Um sie finden zu können, tut es Not, selbst still zu werden – wenigstens manchmal. Das ist ganz leicht und zugleich ganz schön schwer. Ich muss jetzt meine Stille unterbrechen, denn meine beiden Vögel lärmen. Sie fordern neues Futter und neues Wasser.
Werner Schwanfelder
Auferstehung – die Ausstellung
Auferstehung - die Ausstellung
Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Natürlich, es ist uns allen bekannt, dass die Auferstehung von Jesu Christi das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens ist. Im Neuen Testament ist es wohl die glücklichste Tat Gottes die, für uns Menschen, den Tod in ewiges Leben wendet. Der Begriff leitet sich vom altgriechischen „anástasis“ (Aufstehen) ab und bezeichnet die Erweckung Verstorbener durch Gottes Macht. Theologisch symbolisiert sie eine transformative Neuschöpfung des Leibes und der gesamten Schöpfung.
Im Mittelhochdeutschen gewann das Wort als „ūf-erstān“ seinen Klang und fand im Neuen Testament Anwendung. Nun steht es für die zukünftige Auferstehung der Toten. Paulus überliefert frühe Formeln wie „Christus ist auferstanden“ als urchristliches Bekenntnis aus der Jerusalemer Urgemeinde.
Die Auferstehung Jesu markiert den Sieg über Tod und Sünde, als historisches und transzendentes Werk der Dreieinigkeit: Vaterwille, Christi Macht und Heiliger Geist. Daraus entsteht die christliche Hoffnung auf ewiges Leben. Uns bleibt das verstehen verwehrt und noch mal mehr die Vorstellung von Gläubigen, dass sie bereits jetzt „im Licht der Auferstehung“ leben können. Ohne sie wäre der Glaube leer, wie Paulus betont.
Das Neue Testament berichtet detailliert von der Auferstehung: „Er ist nicht hier; er ist auferstanden“ (Mk 16,6); „Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben“ (Joh 11,25); „Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die mit ihm hinabführen, die in Jesus Christus gestorben sind“ (1 Thess 4,14). Beschreibungen umfassen das leere Grab (Mt 28,1–8), Engelbotschaften und Erscheinungen: Jesus zeigt Wundmale (Lk 24,36–49; Joh 20,19–23), isst mit Jüngern (Lk 24,13–35) und beauftragt zur Mission (Mt 28,16–20).
Die Jünger erlebten anfangs Zweifel und Furcht, hielten Erscheinungen für Geister (Lk 24,37), doch Jesus überwand ihren Unglauben durch Berührungen und Mahlzeiten. Frauen wie Maria Magdalena entdeckten als Erste das leere Grab, was ihre Glaubwürdigkeit im Altertum unterstreicht und gegen Betrug spricht. Paulus nennt Kephas (Petrus), die Zwölf und über 500 Zeugen (1 Kor 15,3–8).
Christen stellen sich eine Neugeburt aus Tod in ein neues Leben vor. Paulus vergleicht es mit einem Samen, der stirbt und Neues sprießt (1 Kor 15,35–44). Praktisch bedeutet dies Endlichkeit annehmen, Sünde meiden und hoffungsvoll handeln. Karl Barth sieht sie als welthistorische Wende vom Tod zum Leben (Kol 1,18), erfahrbar im Glauben. Moderne Ansätze verbinden sich mit Hoffnung: Verwandlung verwesten Leibs wird zu Unvergänglichem (1 Kor 15,35–44).
Philosophen wie Immanuel Kant haben die Auferstehung als vernünftige Idee der Unsterblichkeit der Seele interpretiert, die moralisch begründet ist und nicht wörtlich-leiblich verstanden werden muss. Sie garantiert die Unsterblichkeit der Seele für moralisches Handeln und Glückseligkeit im „höchsten Gut“. Karl Barth betont sie als Offenbarungsgeschehen, das Historiker überfordert und den Vorrang Gottes zeigt. Sokrates’ Logos-Überzeugung von der Seelenunsterblichkeit fließt ein, wie Kant anknüpft.
Schriftsteller wie Dostojewski oder moderne Autoren wie Emmanuel Carrère thematisieren sie als Skandal oder transformative Kraft, oft in Romanen oder Essays. Gabriele Wohmann beschreibt die Auferstehung als „alles oder nichts“, Ulrich Schacht als mehr als leeres Grab. Leo Tolstoi und J.M. Coetzee greifen sie in Romanen auf. Emmanuel Carrère nennt sie „Skandal“ für Gottlose, doch zentral für christliche Narrative.
Ich frage mich, ist Auferstehung beschreibbar? Bereits im Neuen Testament wird die Auferstehung nicht als ein beobachteter Vorgang beschrieben, sondern lediglich definiert als die alleinige Tat Gottes. Bezeugt werden nur die Folgen, ein leeres Grab und die Erscheinungen. Auferstehung erscheint als visionäre Enthüllung, keine Halluzination. Apokryphen wie Petrusevangelium beschreiben dramatisch: Jesus wächst riesig aus dem Grab, strahlt göttlich. Auferstehung überwindet objektive Beweise, fordert Vertrauen auf Gottes Vorrang. Ich habe niemanden gefunden, der Auferstehung beschreiben konnte. Auch mir fehlen die Worte. Aber ich habe das Gefühl, man kann die Auferstehung in Bildern darstellen. Ich habe einen solchen Versuch unternommen.
Auferstehung – die Ausstellung
Ausstellung Auferstehung 2026/2027

Ausstellung über Auferstehung
In den vergangenen zwei Jahren durfte ich meine Ausstellung „Weg der Kreuze“ in mehreren Gemeinden in Nürnberg und Fürth präsentieren. Diese Veranstaltungen fanden großen Anklang und wurden von der Presse gewürdigt. Die Ausstellung diente vielen Gemeinden als inspirierender Impuls für Gottesdienste und andere Aktivitäten.
Für mein neues Projekt plane ich nun eine Ausstellung über das Thema Auferstehung. Meiner Meinung nach reichen menschliche Worte nicht aus, um das Konzept der Auferstehung angemessen zu beschreiben. Vielmehr kann die Darstellung durch Bilder einen besseren Zugang zur Auferstehung bieten. Visuellen Eindrücke bieten eine größere emotionale Möglichkeit der Interpretation. Einige Ideen dazu finden Sie unter folgendem Link: Auferstehungs-Impressionen.
Die Ausstellung, bestehend aus etwa 16 Bildern, wird der Kirchengemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie kann für eine vereinbarte Zeitspanne in den Gemeinderäumen oder in der Kirche ausgestellt werden. Die Eröffnung erfolgt im Rahmen einer Vernissage, bei der ich einige Worte zur möglichen Interpretation der Werke sprechen werde. Musikalisch wird mich mein Freund Siegfried Staab begleiten. Besonders freue ich mich darauf, wenn Sie die Bilder in Ihre Gemeindearbeit integrieren.
Gemeinsam stark! Wie Zuwanderer unsere fränkischen Städte und Dörfer bereichern!
Gemeinsam stark!
Wie Zuwanderer unsere fränkischen Städte und Dörfer bereichern
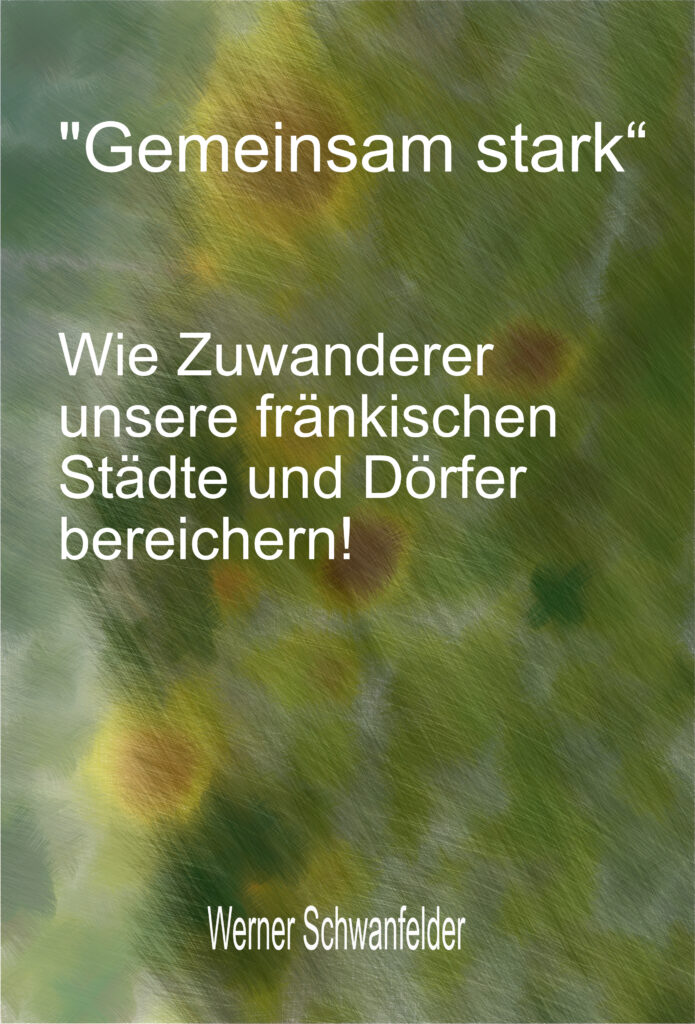
So entstand dieses Buch
Jedes Buch hat eine Geschichte. Dieses Buch hat eine ganz besondere Geschichte, denn es war nicht geplant. Es entstand sozusagen von selbst.
Ich beginne ganz am Anfang. In unserer Gesellschaft gibt es immer wieder, immer noch, und es wird wohl nicht aufhören, Diskussionen über Migration. Diese werden immer wieder hochgekocht durch die AfD und natürlich durch den größten Staatsmann aller Zeiten, den amerikanischen Präsidenten. Ich bin, wie viele andere vernünftige Menschen auch, der Meinung, dass wir Migration unbedingt benötigen. Die Diskussion um die Rente hat das einmal mehr bewiesen. Natürlich, das soll auch gleich gesagt werden, illegale und kriminelle Personen sollten wir schnellstmöglich aus dem Land hinauswerfen. Aber die anderen, die unsere Demokratie, unsere Gesellschaft und unsere Lebensart befürworten und unterstützen, sollen bleiben und sich an der Schaffung unseres Bruttosozialprodukts beteiligen.
Ich habe dann wieder einmal in meinem Buch „111 Orte in Mittelfranken, die man gesehen haben muss“ geblättert. Dort beschreibe ich, wie die Hugenotten so manche fränkische Ortschaft vor dem kompletten Verfall gerettet haben. Auch den Juden haben wir viel zu verdanken; sie haben unsere Gesellschaft bereichert. Das trifft auch auf die heutigen Migranten zu. Ohne sie könnten wir so manches Krankenhaus schließen.
Diese Überlegungen führten mich dazu, eine Lesung mit Bild und Ton zum Thema Migration in unseren fränkischen Orten zu erstellen. Für diese Recherche habe ich mich sehr ausgiebig mit Künstlicher Intelligenz beschäftigt. Dabei habe ich festgestellt, dass die KI tatsächlich viele Informationen bereitstellen kann, die man mit einer normalen Suche nur sehr mühsam finden würde. Die KI ist nicht immer fehlerfrei; deshalb habe ich die eine KI von einer anderen überprüfen lassen. Damit dürfte wohl sichergestellt sein, dass keine Fehler mehr im Text vorhanden sind. Im Anschluss habe ich auch versucht, von der KI Bilder generieren zu lassen, die ich selbst nicht mehr fotografieren kann, wie zum Beispiel Hugenotten, die sich gerade auf der Flucht befinden oder in Nürnberg und Fürth ankommen. Die KI kann das. Sie kann zwar keine typischen Bilder einer Stadt erzeugen (man kann also zum Beispiel Fürth in einem Bild nicht erkennen), aber sie kann die damalige Atmosphäre in einer Abbildung sehr gut einfangen.
Ich hatte so viel Material, von dem ich nur ein Minimum in meinem Vortrag unterbringen kann. Er darf nicht länger als 60 oder 75 Minuten dauern. So stand ich vor der Frage, was ich mit all meinem anderen Material machen soll. Als Bücherschreiber fällt mir dann schnell eine Lösung ein: Ich mache darüber ein Buch. Und so ist dieses Buch eben entstanden. Es ist ein Buch über die Migration in unseren fränkischen Ortschaften und Städten.
Ich habe festgestellt, dass es beeindruckend ist, von welchen Migrationswellen wir bereits profitiert haben. Mit diesem Buch und auch mit dem Vortrag möchte ich einen Beitrag zu der eingangs erwähnten Diskussion leisten. Vielleicht wird der eine oder andere, der die Geschichten und Erlebnisse der Vergangenheit bei meiner Lesung hört oder im Buch liest, offener und einsichtiger werden, die Notwendigkeit begreifen, dass Migration für uns und unsere Gesellschaft lebensnotwendig ist. Ich hoffe nun, dass die Leser ebenso begeistert von diesem Thema sind, wie ich es war und bin, und wünsche ihnen ein gutes Lesevergnügen.
Unser neues Projekt: Gemeinsam stark
Musikalische Lesung: "Gemeinsam stark: Wie Zuwanderer unsere fränkischen Städte und Dörfer bereichern!"

„Gemeinsam stark: Wie Zuwanderer unsere fränkischen Städte und Dörfer bereichern!“
Erleben Sie eine fesselnde musikalische Lesung, die den unschätzbaren Wert von Zuwanderung in unseren fränkischen Gemeinden beleuchtet! Unter dem Titel „Gemeinsam stark“ nehmen Sie Werner Schwanfelder (Text) und Siegfried Staab (Musik) mit auf eine Reise durch die bewegte Geschichte unserer Region, in der Menschen aus aller Welt – von Juden und Hugenotten über Österreicher und Sudetendeutsche bis hin zu den heutigen Syrern und Ukrainern – dazu beigetragen haben, das Gesicht unserer Städte und Dörfer zu formen.
In einer Zeit, in der die Debatte über Zuwanderung heiß geführt wird, schaffen wir Raum für Reflexion und Verständnis. Die Texte erinnern uns daran, dass Zuwanderung kein neues Phänomen ist. Schon in der Vergangenheit erlebten wir Zeiten, in denen Dörfer menschenleer waren, bis mutige Siedler aus Frankreich und Österreich neue Hoffnung brachten. Gastarbeiter retteten unsere Industrie in Krisenzeiten und trugen maßgeblich zum Wirtschaftswunder bei. Und auch heute ist Migration die Lösung für den sichtbaren Fachkräftemangel.
Begleitet von einfühlsamer Musik wird diese Lesung eine andere Sicht auf Migration öffnen. Vielleicht werden Vorurteile abgebaut, neue Erkenntnisse gewonnen. Wir betrachten die emotionalen Facetten von Zuwanderung und deren weitreichende Auswirkungen auf unsere Wirtschaft, Kultur und das soziale Gefüge. In einer globalisierten Welt erkennen wir, dass Migration nicht nur Herausforderungen mit sich bringt, sondern auch eine Chance für kulturelle Bereicherung und gesellschaftliche Innovation darstellt.
Wir erzählen von Orten in Franken, die ihre Existenz Zuwanderern verdanken, von baulichen Zeugnissen aus der damaligen Zeit, von Gedenkstätten, die einen Dank ausdrücken.
Trump und Gott
Trump und Gott

Es ist unbestreitbar, dass Trump einen starken Eindruck hinterlässt – leider negativ. Besonders fasziniert mich das Spannungsverhältnis zwischen Trump und Gott. Der US-Präsident hat wiederholt erklärt, dass die Bibel sein Lieblingsbuch sei. Angesichts dieser Aussage stellt sich die Frage: Was ist mit den Zehn Geboten? Gelten sie auch für ihn? Schließlich steht da unter anderem: „Du sollst nicht lügen.“
Trump hat sich selbst zum Apostel der „America Prays“-Bewegung erhoben. Er behauptet, dass eine großartige Nation Religion benötigt, was auch das Gebet einschließt. Er fordert die Amerikaner auf, mindestens eine Stunde pro Woche gemeinsam zu beten. Doch wer betet mit wem? Mit einem Mann, für den die Bibel anscheinend vor allem ein Geschäft ist. Die Trump-Bibel verkauft sich gut. Schließlich wird sie billig in China hergestellt. Jetzt sind die Prerise gestiegen wegen der Zölle. Sie wird für 99,99 Dollar angeboten. Berichten zufolge hat Trump damit bereits 1,5 Millionen Dollar eingenommen.
Ein weiteres Zitat ist von ihm publiziert worden: „Wir lieben Gott und müssen alles verteidigen, was pro Gott ist.“ Doch was bedeutet „pro Gott“ genau? Auf die Frage nach seinem Lieblings-Vers aus der Bibel konnte Trump keine Antwort geben. Ich vermute, dass er eher das Alte Testament („Auge um Auge“) bevorzugt als das Neue Testament („Halte auch die andere Wange hin“).
Die USA sind reich an Kirchen; es gibt unzählige davon, was den Anschein erweckt, als seien die Amerikaner christlich. Schaltet man das Radio ein, stößt man schnell auf christliche Sender. Selbst im deutschen Bibel TV haben amerikanische Pastoren ein ständiges Rederecht, und die weiblichen Prediger sind die wahren Hardliner.
Allerdings sind es gerade die evangelikalen Trump-Anhänger, die gegen Einwanderer hetzen. Hier wird nicht mit Schimpfworten gespart. Vizepräsident J. D. Vance ist zum Katholizismus konvertiert und bekennt öffentlich, dass er Immigranten und Kriminelle aus seiner Nächstenliebe ausschließt. Ist das Teil des amerikanischen Katholizismus? Dagegen hat sogar der Papst protestiert.
Ich hatte schon immer Schwierigkeiten damit, wie man Aktivitäten wie „Pro Life“, also den Schutz des ungeborenen Lebens, mit der Todesstrafe in Einklang bringen kann. Für Trump-Anhänger scheint dies jedoch kein Problem zu sein.
Ich nehme an, dass im Verständnis von Vance Nächstenliebe auch das Festnehmen von Immigranten umfasst. Vermummte ICE-Agenten verhaften Immigranten auf den Erntefeldern und fesseln halb nackte Kinder mit Kabelbindern (wie in Chicago geschehen). Für Vance durchaus christliches Handeln. Man könnte dies als Kreuzzug verstehen in einem der christlichsten aller christlichen Länder.
Laut Umfragen geben 62 Prozent der Amerikaner an, Christen zu sein. Viele von ihnen wählten Trump, obwohl sie wussten, dass er wohl gegen alle zehn Gebote verstößt. Wie steht es mit den Geboten „Nicht lügen“, „Nicht stehlen“, „Nicht töten“? Das fünfte Gebot wird sicherlich nicht beachtet, wenn ein venezolanisches Boot ohne Beweise in die Luft gesprengt wird. Vielleicht sollte man dies nicht so eng sehen, denn auch frühere Präsidenten hielten sich nicht immer an die Gebote, sie äußerten sich nur nicht so unverblümt.
In Matthäus 5,44 heißt es: „Liebe deine Feinde.“ Trump hingegen sagt: „Ich hasse meine Gegner.“ In unflätiger Weise beschimpft er die Opposition als eine Partei des Hasses, der Sünde und des Satans. Vermutlich hält er die Bergpredigt für ein Immobilienprojekt in Florida und Blasphemie für eine sündige Massage.
Auf vielen Bildern tragen seine Anhänger große silberne Kreuze um den Hals, die allerdings nicht zur Vergebung gedacht sind, sondern eher der Rache dienen.
Der rechtsextreme Kriegsminister Pete Hegseth verbreitet Videos, in denen er Psalmen zitiert: „Ich jagte meinen Feinden nach, ich holte sie ein und kehrte nicht um, bis sie vernichtet waren.“ In seiner Bibelauslegung ist der Mann der Frau grundsätzlich überlegen. Der weiße Christ ist offenbar Gottes Liebling. Es ist kaum überraschend, dass sein Priester sogar vorschlägt, Frauen das Wahlrecht zu entziehen.
In Genesis 2,15 gibt Gott dem Menschen den Auftrag, den Garten Eden zu hüten. Trump hingegen bezeichnet die Klimakrise als „den größten Schwindel aller Zeiten“ und setzt lieber auf neue Ölbohrungen. Während Matthäus 23 zur Bescheidenheit aufruft, erklärt Trump: „Ich wurde von Gott gerettet, um Amerika großartig zu machen.“ Man könnte fast annehmen, dass Gott hier blind war.
Trump und seine Anhänger warnen vor dem Antichristen und diffamieren all jene, die ihnen widersprechen, als satanisch. In den USA verschwimmen die Grenzen zwischen Gut und Böse. Würde Jesus in Kalifornien auferstehen, würde die Trump-Kampagne ihn wahrscheinlich als radikalen linken Aktivisten betrachten. Trump sagt, er wolle in den Himmel kommen. Manche hoffen, dass dies bald erfolgt.
Natürlich ist Trump nicht der erste Politiker, der Gott für Wahlkampfzwecke missbraucht. Doch seine Regierung ist die erste, in der Minister artig zum Altar pilgern, nur um danach mit biblischer Brutalität Andersdenkende und Andersfarbige zu verfolgen.
Für viele Amerikaner ist die Situation ernst. Sie könnten vorzeitig sterben, Millionen verlieren ihre Krankenversicherung, und Trump hat Milliarden Dollar aus der Krebsforschung gestrichen. Der Gesundheitsminister will die Impfung abschaffen.
Vielleicht bleibt wirklich nur noch das Gebet – nicht für die Auserwählten, sondern für die Ausgeschlossenen. So wahr uns Gott helfe – oder wenigstens der gesunde Menschenverstand.
Doch wir sollten nicht so laut tönen. Vielleicht erleben wir solche Situationen auch bald in einem AfD-Deutschland. Gott bewahre.
Trump und seine Wähler
Trump und seine Wähler

Trump ist nicht wirklich schuld.
Schuld sind die amerikanischen Wähler.
Die Amerikaner.
Ich habe keine Lust, mich über Trump aufzuregen. Er ist in meinen Augen ein Ekel, ein Krimineller, der viele Menschenschicksale auf dem Gewissen hat. Damit soll es reichen.
Mehr beschäftigt es mich, wer Trump gewählt hat. Das sind die wahren Schuldigen. Wir Deutsche wissen das sehr gut. Wir haben einst Hitler an die Macht gewählt. Dafür tragen und trugen wir die Verantwortung und auch die Schuld. So geht es nun den Amerikanern. Damals waren sie unsere Befreier. Vor 80 Jahren haben die Nürnberger Prozesse begonnen, die gerade von den Amerikanern und ihrem damaligen Präsidenten Franklin initiiert worden sind. Das war ein vorbildliches Lehrstück an Demokratie.
Vor einem Jahr haben sie einen Scharlatan zum Präsidenten gewählt, der bereits im Wahlkampf sehr deutlich gemacht hat, wie er regieren will. Und mit dem die Amerikaner bereits Erfahrung in einer vorhergehenden Präsidentschaft gemacht hatten. Keiner kann sich herausreden. Jeder hat es gewusst. Deshalb ist die Schuld umso größer.
Wer hat nun Trump gewählt? Die Ergebnisse waren beeindruckend. Die Mehrheit der Amerikaner hat ihn gewählt. Man kann leider nichts relativieren.
Ich habe eine Studie gelesen, auf die ich mich hier auch beziehe, über die Bevölkerungsgruppen, die Trump gewählt haben. Das Ergebnis finde ich sehr interessant.
Beginnen wir mit der republikanische Kerngruppe: Mit 31 Prozent der Trump-Wähler sind sie, die Erz-Konservativen, die größte Gruppe der Trump-Koalition. Sie sind religiös und vertreten die klassischen republikanischen Positionen: gegen Staatsverschuldung, gegen Abtreibung, gegen die Schwulenehe, gegen die Einmischung der Regierung in ihr Leben, gegen Obamas Gesundheitsreform, gegen das Verbot von Waffen, gegen das Pariser Umweltabkommen. Diese Gruppe wählt konsequent republikanisch, egal, wer der Kandidat ist.
Die zweite Gruppe sind die Verfechter des freien Marktes. Sie sollen 25 Prozent der Trump-Wähler ausmachen. Das sind durchaus wohlhabende, eher gebildete Amerikaner, bei sozialen Themen oft sogar fortschrittlich, vor allem aber daran interessiert, der Marktwirtschaft keine Fesseln anzulegen.
Die kleinste Gruppe: Die Unpolitischen. Sie machen nur fünf Prozent aus. Politik interessiert sie kaum, aber sie lehnen jegliche Einwanderung entschieden ab.
Es folgen die Anti-Eliten. Sie sind eine Gruppe von 19 Prozent. Politisch sind sie eher in der Mitte anzusiedeln, auch in der Einwanderungsfrage. Aber sie sind eben gegen das Establishment.
Und schließlich die Gruppe, die zu einem großen Teil früher Demokraten waren: das sind die Bewahrer eines weißen, christlichen Amerikas. Diese Gruppe von 20 Prozent sind wenig gebildet und haben geringe Einkommen. Viele sind arbeitslos und die Hälfte haben Medicaid, die staatliche Krankenversicherung für Geringverdienende, Kinder, Alte und Behinderte. Man würde sie eigentlich nicht für Republikaner halten. Sie befürworten Steuererhöhungen für die Reichen, sie machen sich Sorgen um ihre Krankenversicherung, sie sind für eine eher linke Wirtschaftspolitik. Aber sie sind vor allem gegen jegliche Einwanderung und haben starke Vorbehalte gegen ethnische Minderheiten. Diese Gruppe stimmte weitgehend gegen ihre eigenen Interessen und wählte Trump fast ausschließlich, weil auch er unaufhörlich gegen Einwanderer hetzte.
Besonders der letzten Gruppe ist eine gehörige Dummheit zu unterstellen. Sofern Sie wirklich Christen sind, sollte man ihnen sagen, dass sie sich versündigt haben.
Verantwortlich sind alle Amerikaner, die Trump gewählt haben. Viele werden die Konsequenzen bald schmerzlich bemerken. Sie werden es an ihrem Geldbeutel feststellen.
In der Welt verfestigt sich wieder das Bild des hässlichen Amerikaners. Aus der Ferne wirkt dies wie ein gefährliches Experiment. Da irrlichtert einer durch die Welt, der macht, was er will, weil er es kann. Er nimmt seine Bürger und gleich die ganze Welt in Geiselhaft. Adieu Demokratie.
Herbst in Land und Leben – über die Menschenrechte

Herbst in Land und Leben - über die Menschenrechte
Es wird gerade Herbst. Das Wetter unterstreicht dies mit Nachdruck. Ich lebe in meinem Lebens-Herbst und die Welt, so habe ich den Anschein „herbstet“ ebenfalls. Die tägliche Zeitungslektüre hat mich motiviert, darüber nachzudenken, in welcher Welt wir eigentlich leben. Ich habe mich beim Menschenrechtsbericht der UN darüber informiert.
In meinem Leben habe ich die politische Erfahrung gemacht, dass Menschenrechte das unverzichtbare Fundament für florierende Gesellschaften sind, das verbindende Element des Vertrauens zwischen den Bürgern und ihren Regierungen. Die Menschenrechte waren für mich immer eine Hoffnung auf eine bessere Welt, die gewaltsame Konflikte, Brutalität und Ungerechtigkeit ablehnt.
Dennoch beobachten wir weltweit besorgniserregende Trends, die eben diese Menschenrechte gefährden. Kriegspropaganda ist überall präsent, von Militärparaden bis hin zu übertriebener Rhetorik. Leider fehlen Friedensparaden und Friedensministerien. Gewalt wird glorifiziert, das Völkerrecht über Bord geworfen. An die globale Ordnung sehen sich viele Staaten nicht mehr gebunden. Das Recht des Stärkeren wird zur Norm.
Ich habe mich bemüht, die Brennpunkte der Welt einmal aufzulisten. An erster Stelle steht der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Er hat sich nicht zuletzt durch das tollpatschige Verhalten von Trump weiter verschärft. Im Juli wurden mehr Zivilisten getötet und verletzt als in jedem Monat seit Mai 2022. In den letzten Wochen kam es zu einigen der verheerendsten Luftangriffe mit Drohnen und Raketen seit Beginn des Krieges. Das alles sind schwerwiegende Verstöße gegen das Völkerrecht.
Im Sudan ignorieren sowohl die Rapid Support Forces als auch die sudanesischen Streitkräfte das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte. Tausende Zivilisten sind ums Leben gekommen, die Feindseligkeiten in Darfur und Kordofan haben sich verschärft. Das Leid der sudanesischen Bevölkerung in diesem riesigen Land ist unvorstellbar. Sexuelle Gewalt ist weit verbreitet, insbesondere gegen vertriebene Frauen und Mädchen.
Vier Jahre nach dem Putsch sind die Menschen in Myanmar von einer katastrophalen Menschenrechtslage betroffen. Das Militär attackiert Zivilisten in ihren Dörfern mit Luftangriffen und Bombardierungen sowie mit willkürlichen Verhaftungen, Folter, sexueller Gewalt und Zwangsrekrutierungen.
In der Demokratischen Republik Kongo gibt es überwältigende Beweise für anhaltende schwere Menschenrechtsverletzungen und Missbräuche durch alle Konfliktparteien.
Israels massenhafter Angriff auf palästinensische Zivilisten in Gaza bedeutet unermessliches Leid und eine umfassende Zerstörung, die man sich gar nicht vorstellen kann. Die Behinderung ausreichender lebensrettender Hilfe und die daraus resultierenden Hungertoten unter der Zivilbevölkerung, die Tötung von Journalisten, UN-Mitarbeitern und NGO-Vertretern sowie die Begehung eines Kriegsverbrechens nach dem anderen schockieren das Gewissen der Welt.
Die Entwicklung in der Türkei ist ebenfalls besorgniserregend. Seit dem Putsch (2016) verwandelt Erdoğan das Land in eine Diktatur. Der Präsidentschaftskandidat der Opposition, Ekrem İmamoğlu, wurde verhaftet ohne glaubhafte Anklage. Noch kann man in der Türkei seine Meinung sagen, wenngleich nicht über alle Themen reden. Die USA nehmen einen ähnlichen Weg. Jetzt haben Donald Trump und seine Maga-Bewegung in Charlie Kirk einen Märtyrer gefunden. In der Türkei lässt sich studieren, was aus einem solchen Schockmoment folgen kann: autoritäre Politik. Erdoğan nannte den Putschversuch ein „Geschenk Gottes“, er begann, Gegner zu verfolgen, mit dem Putsch als Vorwand. Teils liegt es daran, dass Herrschende wie Erdoğan oder Trump von ihrer historischen Mission überzeugt sind. Dass sie das Land retten müssen – vor den Anderen. Sind die USA ein ganz anderes Land als die Türkei? Sicher. Das türkische Beispiel zeigt, wie schnell es gehen kann. Dass in den USA ein Präsidentschaftskandidat ins Gefängnis kommt? Unvorstellbar. Noch, aber das Justizministerium hat den Auftrag demokratische Politiker vor Gericht zu bringen und mundtot zu machen. Der demokratische Minderheitsführer Schumer sieht die USA bereits auf dem Weg in die Diktatur.
Da ist es fast nebensächlich, wenn Burkina Faso, Mali und Niger die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft verlassen. Venezuela hat erklärt, sich aus der Gerichtsbarkeit des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte zurückzuziehen. Die Russische Föderation ist aus der Europäischen Menschenrechtskonvention ausgetreten.
Exzessive Gewaltanwendung und der Tod von Menschen afrikanischer Abstammung durch Strafverfolgungsbehörden sind in vielen Staaten weiterhin an der Tagesordnung und wurzeln oft in systemischem Rassismus. Indigenen Völkern wird weiterhin ihr Recht auf Land verweigert. Verstöße gegen die Rechte der Roma sind in mehreren europäischen Ländern und darüber hinaus weit verbreitet, einschließlich Polizeigewalt, Hassreden und systematischer Ausgrenzung. In China sind die Uiguren und andere muslimische Minderheiten in Xinjiang mehr oder weniger rechtlos. Dies gilt auch für die Tibeter in ihren Regionen.
Die Rechte von LGBTQ+-Personen werden in Westafrika zunehmend eingeschränkt. In Argentinien wirken sich die Sparmaßnahmen am stärksten auf Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen aus.
Mehrere Länder kürzen weltweit wichtige Programme zum Schutz der Frauenrechte, einschließlich der Unterstützung von Gewaltopfern und dem Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheitsversorgung. Müttersterblichkeit bleibt eine der häufigsten Todesursachen für die am stärksten marginalisierten Frauen und Mädchen. Afghanistan, wo der Zugang von Frauen zur Gesundheitsversorgung – neben vielen anderen Menschenrechten – stark eingeschränkt ist, hat eine der höchsten Müttersterblichkeitsraten weltweit. Vier Jahre nach der Rückkehr der Taliban sind Frauen und Mädchen nahezu vollständig aus dem öffentlichen Leben verschwunden.
Die Verletzung der Rechte von Migranten und Flüchtlingen werden in einigen Ländern zur Norm. Pakistan und der Iran haben Millionen von Afghanen zwangsweise in ihr Land zurückgeschickt, und Indien hat Gruppen von Rohingya-Muslimen auf dem Land- und Seeweg abgeschoben.
Kuwait hat in den letzten Jahren Tausenden von Menschen die Staatsbürgerschaft entzogen, wodurch viele staatenlos wurden. In Kambodscha ermöglichen Änderungen der Verfassung und des Staatsangehörigkeitsrechts den Behörden, im Falle von Hochverrat die Staatsbürgerschaft zu entziehen, was ihnen weitere Möglichkeiten eröffnet, Kritiker ins Visier zu nehmen.
Weltweit erleben wir einen Anstieg von Antisemitismus, Islamophobie, Homophobie, Rassismus und großangelegten Desinformationskampagnen. Im Tschad, in Nigeria und anderen Ländern der Region werden Konflikte zwischen Viehzüchtern und Bauern durch hasserfüllte Narrative angeheizt und eskalieren zu tödlichen Zusammenstößen. Von Südsudan bis Syrien verschärfen Hassreden die Spannungen und vertiefen die Gräben. Die Lügen und der Nihilismus führen zu realen Angriffen auf Menschen. In Kambodscha und Thailand beispielsweise war die Gehässigkeit in den sozialen Medien ein Faktor für die heutigen Spannungen. In Serbien bleibt Hassrede im Internet oft ungestraft.
Das ist nun eine lange Liste geworden. Damit ist noch nicht der Winter beschrieben. Es kann also noch schlimmer werden. Eine Hoffnung habe ich allerdings. In Umfragen wurde dokumentiert, dass die große Mehrheit der Menschen weltweit nach Menschenrechten und Freiheiten strebt. Demokratische Staaten müssen diesen Prozess weiter unterstützen und dabei positive Narrative für eine kreative Öffentlichkeitsarbeit stärken. Wenn man das Weltgeschehen mit dem Jahr 1945 vergleicht, geht es uns immer noch besser als damals. Ich gestehe allerdings auch, dass ich froh bin im Herbst meines Lebens zu sein.
Das große Buch der Weisheitsgeschichten
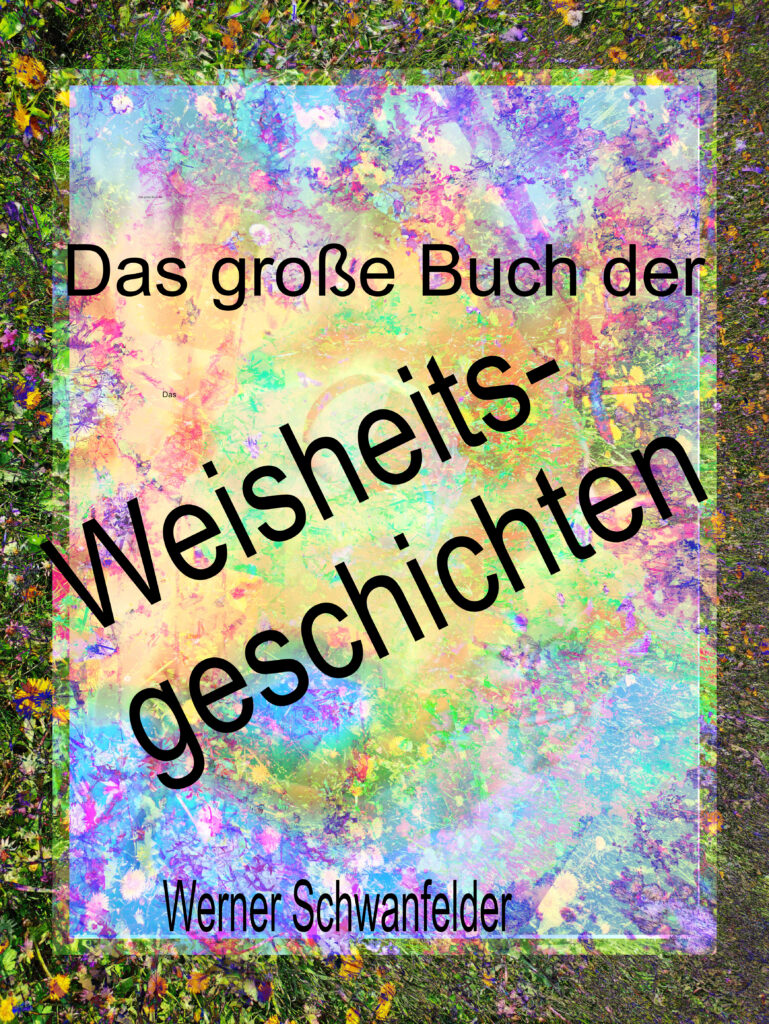
Das große Buch der Weisheitsgeschichten
Entfesseln Sie die Kraft der Weisheit: Ein Buch für die Seele
Weisheit ist ein unschätzbares Gut, das durch die Jahrhunderte fließt und von Generation zu Generation weitergegeben wird. Sie ist der kostbare Rohstoff der Menschheit, der, wenn er gehegt wird, sich unermüdlich vermehrt. In einer Welt, in der sie oft in den Hintergrund gedrängt wird, bleibt die Weisheit dennoch allgegenwärtig – manchmal verborgen, aber stets bereit, wieder ans Licht zu treten.
Mit diesem einzigartigen Buch lade ich Sie ein, die Weisheit zurück ins Zentrum Ihres Lebens zu holen. Es ist ein Schatz, der in kleinen Happen präsentiert wird: durch fesselnde Geschichten, tiefgründige Essays und inspirierende Zitate, die aus den unterschiedlichsten Kulturen und Kontinenten stammen. Diese universelle Weisheit zeigt, dass die Essenz des menschlichen Verstehens über Grenzen hinweg verbindet.
Weisheit entfaltet sich in verschiedenen „Arbeitsstufen“: Sie beginnt im Gedankenraum, entfaltet sich in weisen Überlegungen und findet ihren Ausdruck in der Kommunikation. Doch wahre Weisheit zeigt sich erst durch Taten. Dieses Buch ist ein Wegweiser zur Kommunikation und zur aktiven Anwendung von Weisheit in Ihrem Leben.
Lassen Sie sich von den Inhalten inspirieren! Tauchen Sie ein in eine Welt voller Erkenntnisse und lassen Sie diese in weise Handlungen münden. Entdecken Sie, wie Sie die Weisheit in Ihrem Alltag lebendig werden lassen können – für sich selbst und für die Generationen, die Ihnen folgen.