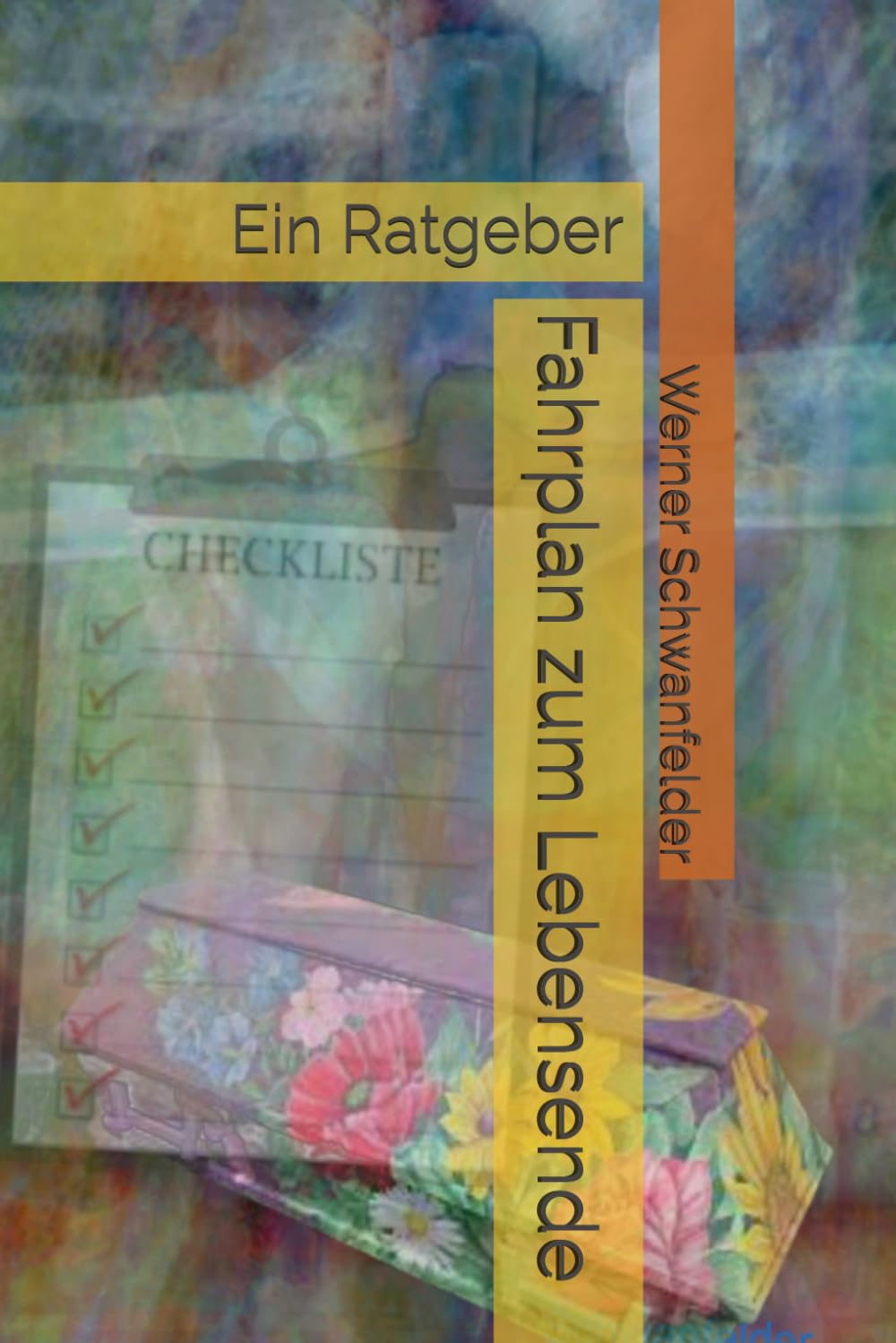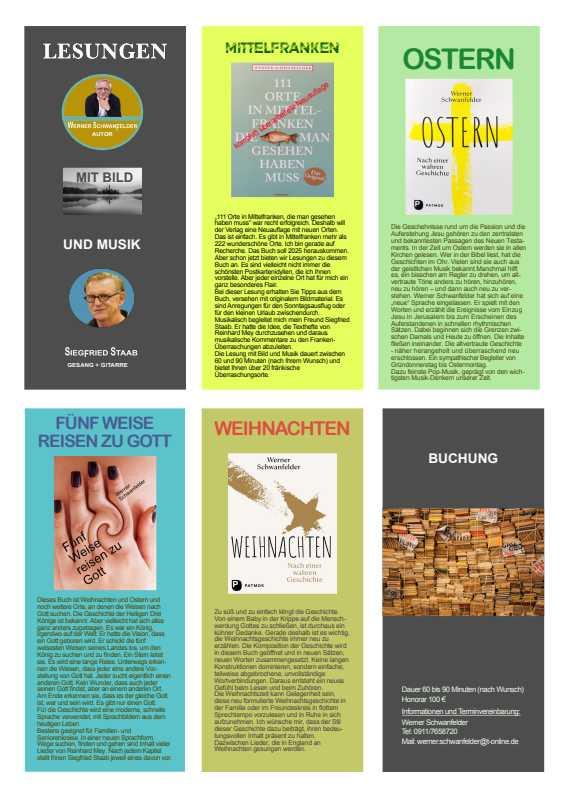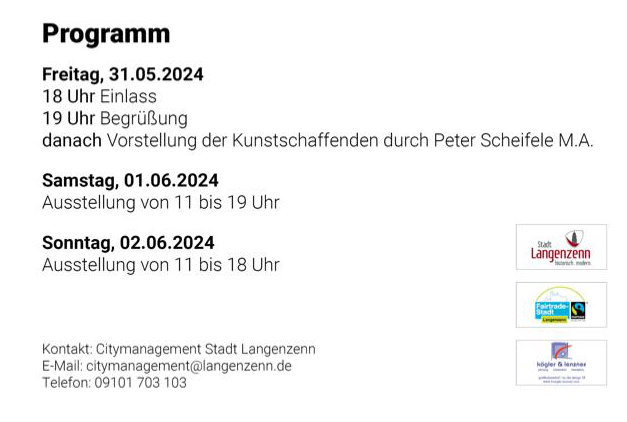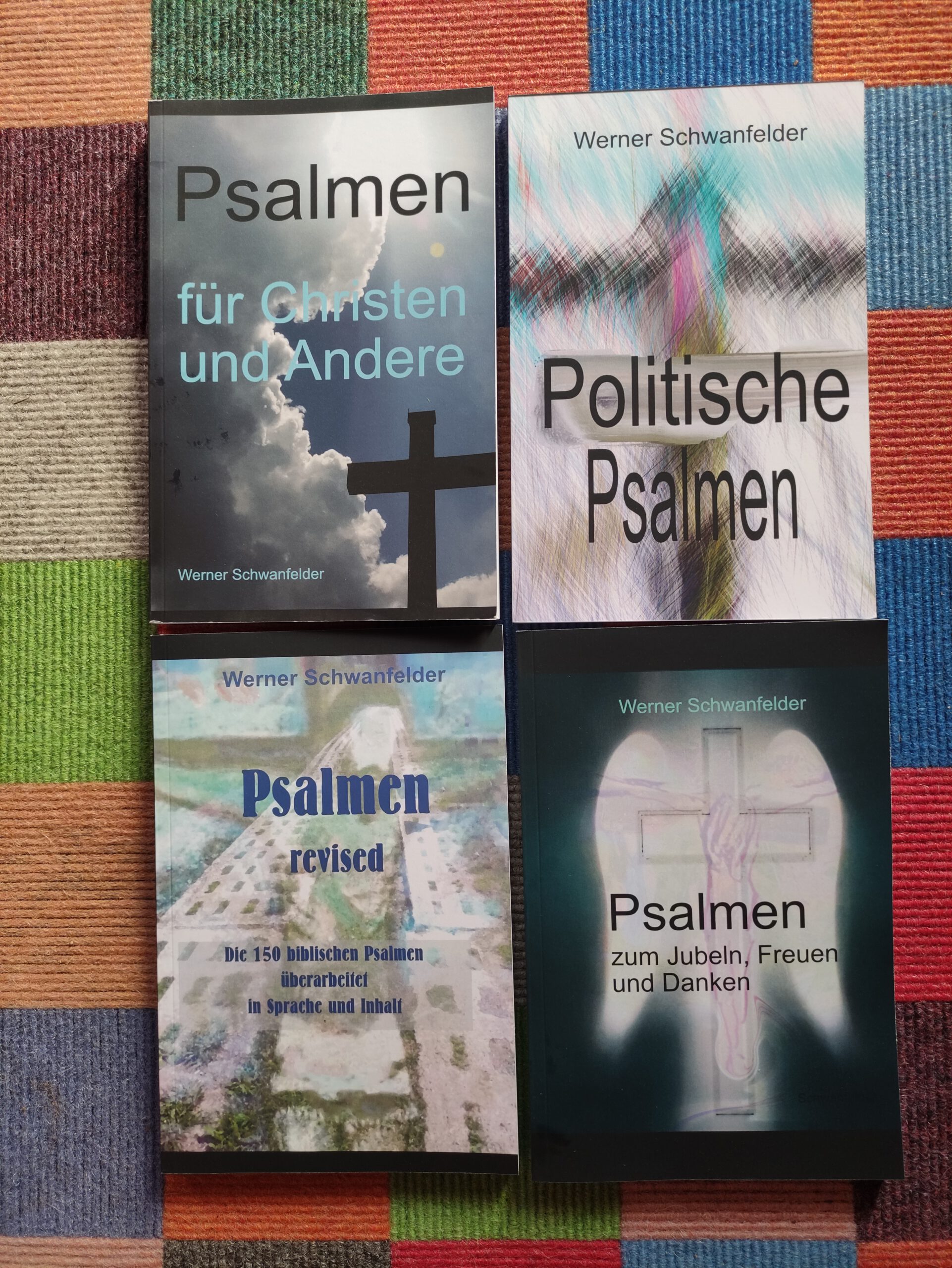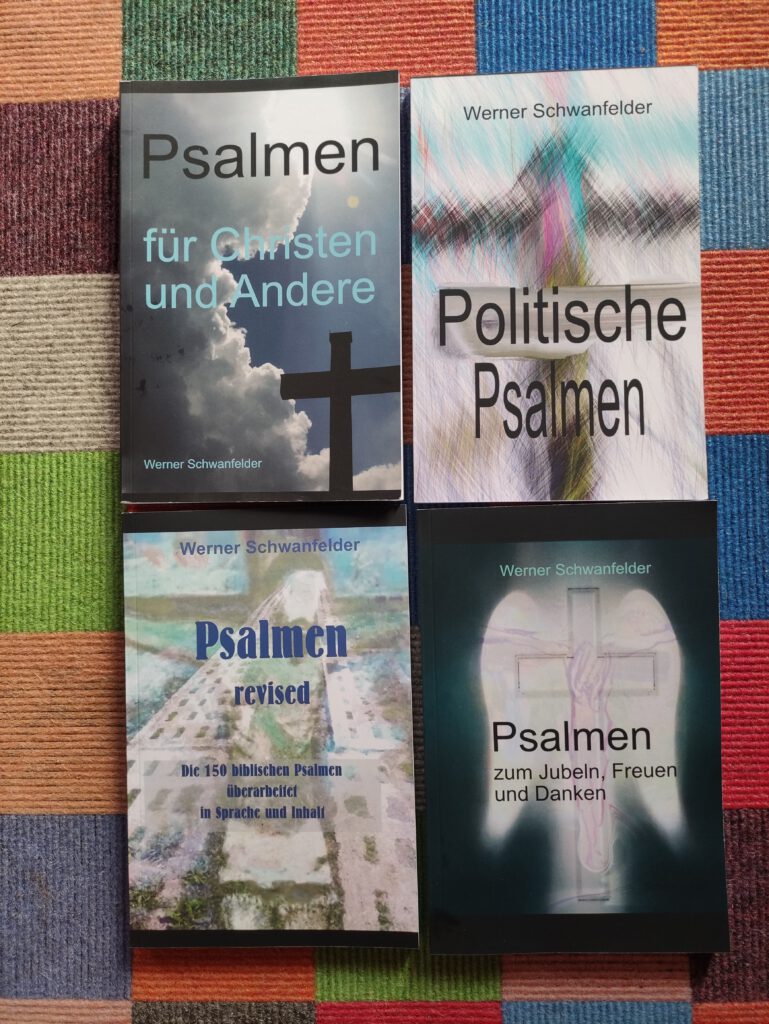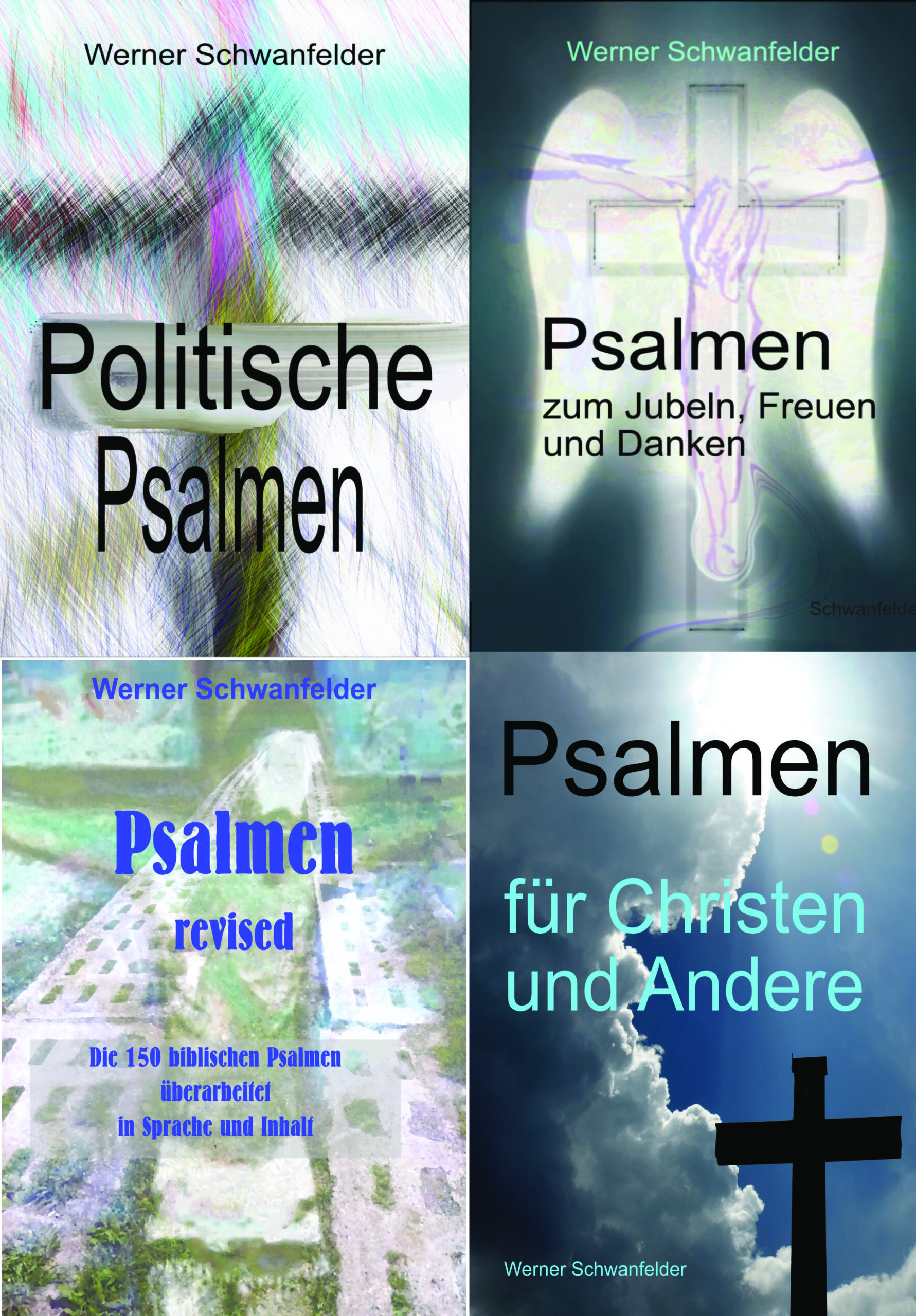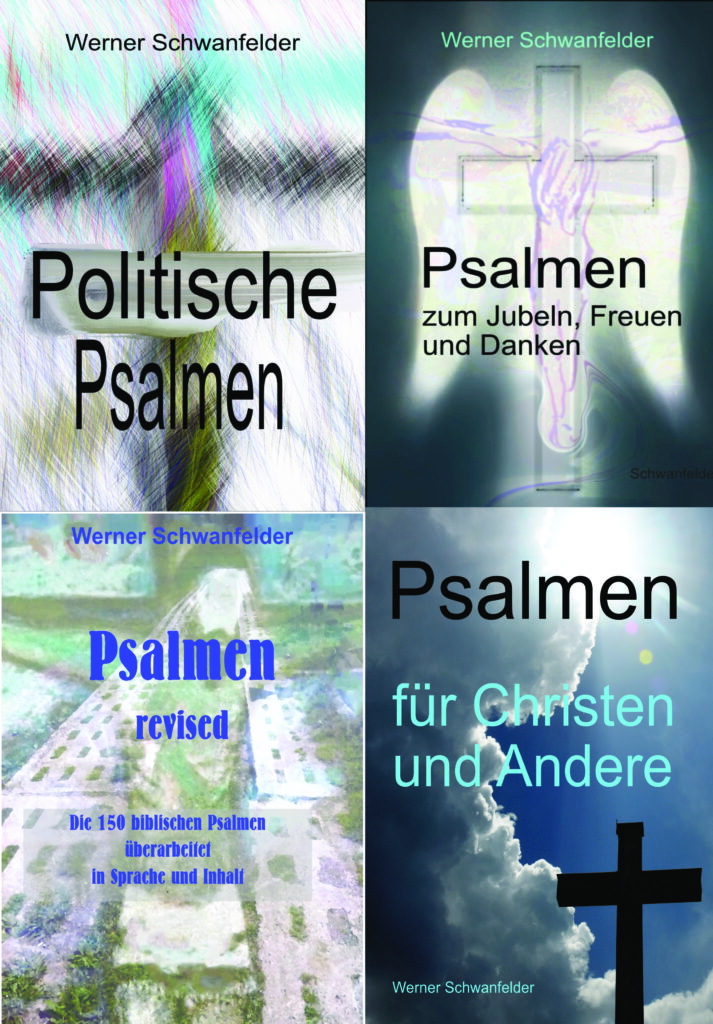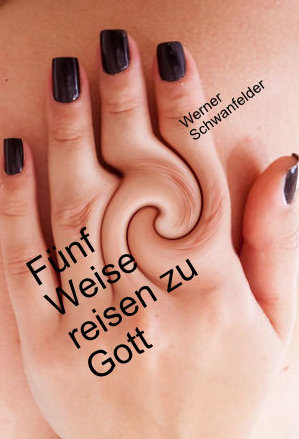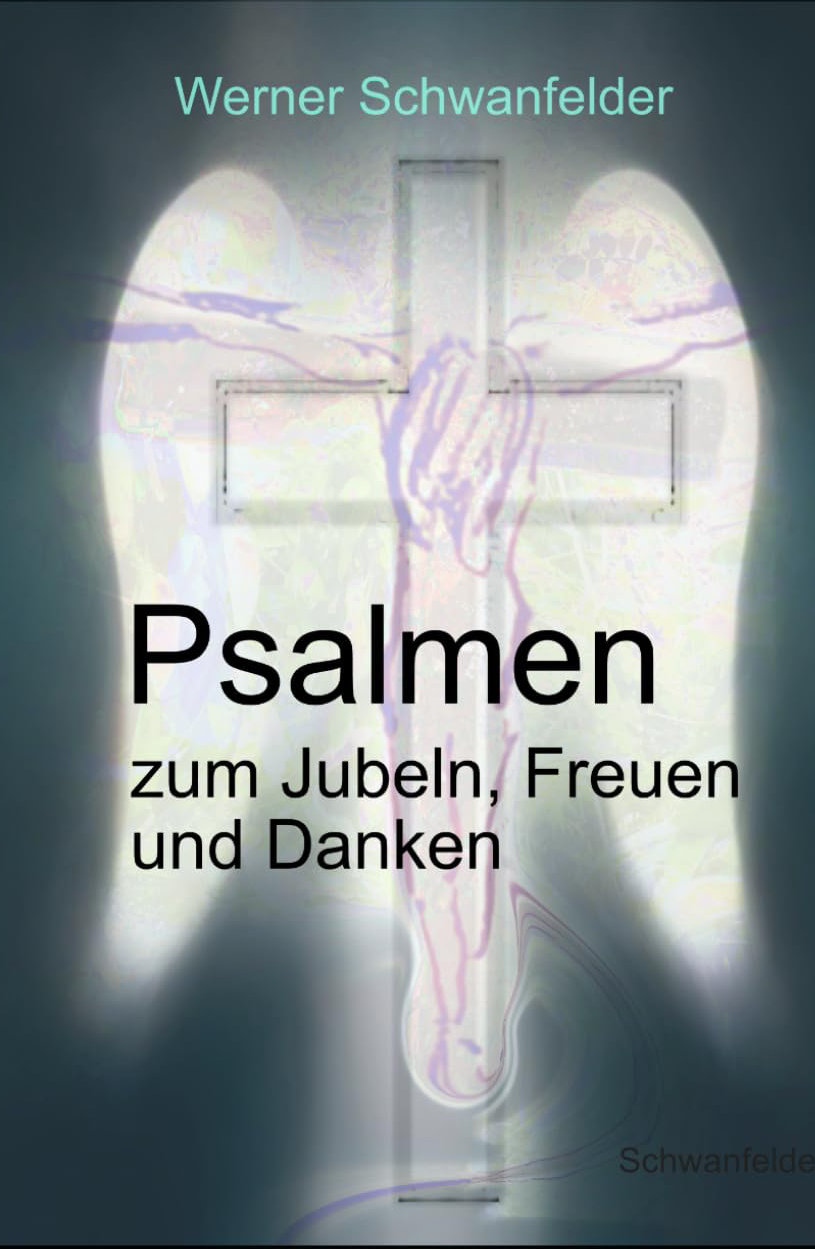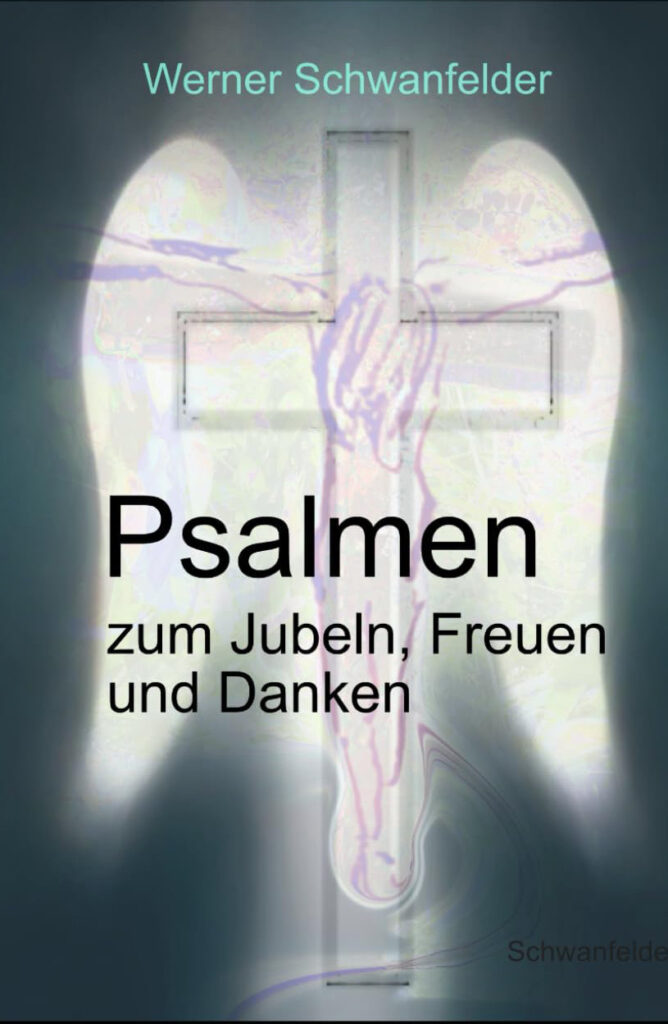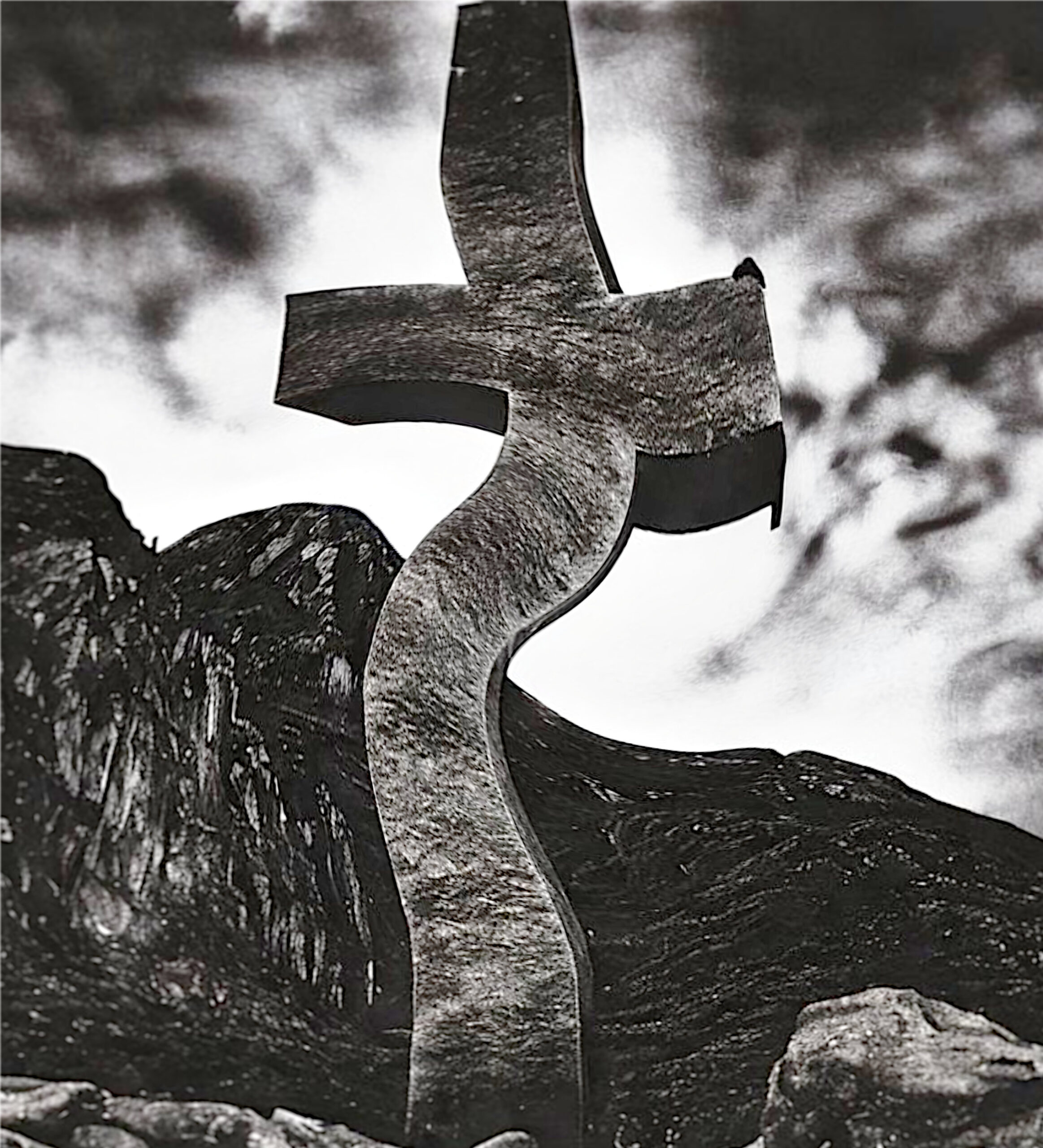Ein neuer Ratgeber: Fahrplan zum Lebensende
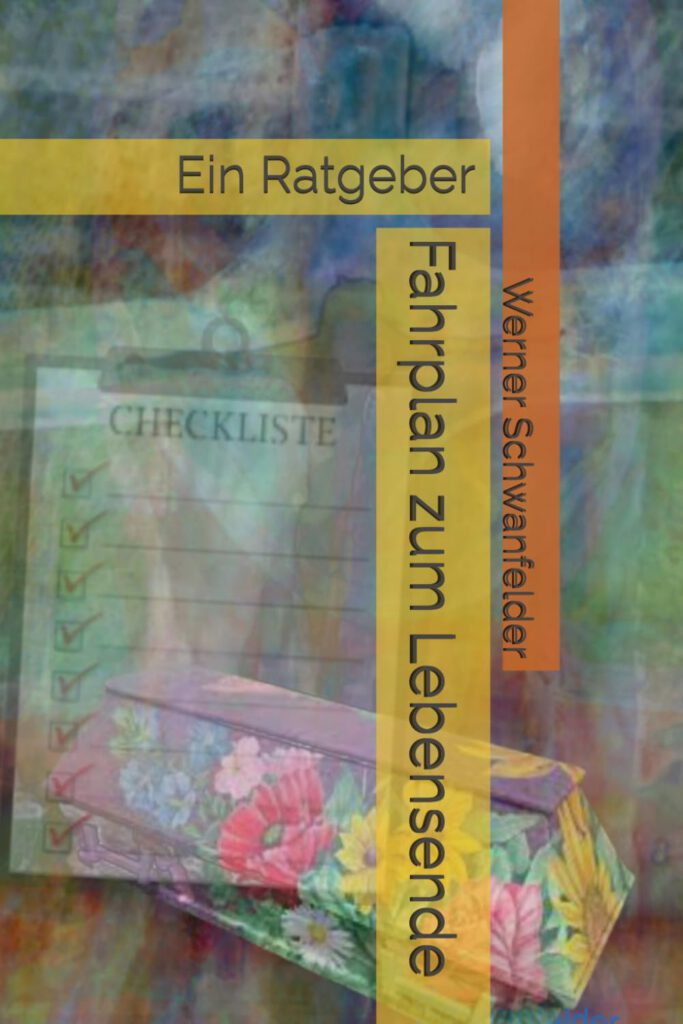
Werner Schwanfelder – Ratgeber: Fahrplan zum Lebensende
Genre: Ratgeber
Setting: Aufbau/Gliederung: eingereichte Gliederung sehr umfangreich und daher unübersichtlich und überfordernd; kursive Kapitel sind die gewichtigen – alle anderen nur als Zwischenüberschriften im Fließtext belassen, aber nicht mit in die Gliederung aufnehmen
Erzählperspektive: Ich-Perspektive, mutet teils an Gedankenstrom an, wenn der Autor seinen persönlichen Überlegungen zum Lebensende einfach freien Lauf lässt (hat seinen eigenen Charme, verliert aber durch Gedankensprünge manchmal an inhaltlicher Stringenz); die faktischen Ausführungen sind klar und präzise, anleitend
Inhalt:
Warum? Ein letzter Ratgeber
Schwanfelder begründet den „Fahrplan zum Lebensende“ aus einer Art therapeutischem Selbstbedürfnis heraus, sich so selbst systematisch auf den Tod vorzubereiten. In diesem Zusammenhang wird bereits in der Einleitung (und später immer wieder) darauf hingewiesen, dass sich der Ratgeber nicht anmaßt, eine allgemeingültige Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine so individuelle Erfahrung wie das Lebensende zu sein. Vielmehr sei es ein „Rat-Begleiter“, der als Vorbereitungshilfe auf den Tod genutzt werden könne.
Das Altern und die Realität des Todes
Der Tod wird eingeführt als wichtiger und vielmehr dankbarer Teil des Lebens, der ebenso selbstverständlich ist, wie die Geburt – aber dem entgegen gesellschaftlich unverhältnismäßig geschmäht. Damit will der Autor argumentativ aufräumen. Schwanfelder führt zu diesem Zweck auch Vergleiche aus dem Tierreich an, um den natürlichen Gang der Dinge wieder in Erinnerung zu rufen. Außerdem nähert er sich dem Tod intuitiv (über subjektive Gedanken, eigenes Vorbereiten auf seinen eigenen Lebensabend) wie auch faktisch (Aufzählung Festtage des Todes, Auswirkung des demographischen Wandels/ Def. Familie auf das Sterben außerhalb des engsten Familienkreises), was das Thema aus verschiedenen Perspektiven komplementär beleuchtet.
Was ist zu tun? Die Vorbereitung (eher: Bestandsaufnahme vom Leben) Rückblick aufs Leben, erprobte Jahresbilanzen des eigenen Lebens und die große Sinnfrage. Die „Nachdenkliste“ zur Vorbereitung auf den Tod lässt Inhalt in schnell erfassbarer Stichpunktform erwarten. Stattdessen handelt es sich hier aber um einen Fließtext, dem lediglich Stichpunkte vorangestellt wurden?? – entweder runterbrechen auf knackige Aussagen oder wie gehabt einfach Fließtext belassen. Teils wird auch nicht klar, was der Autor aussagen will, seine verschriftlichen Überlegungen laufen ins Leere. Es scheint sich hier um eine Zusammenstellung zielloser Gedankenschnipsel zu handeln, die inhaltlich häufig nicht ineinander überleiten und den Lesenden daher verwirrt zurücklassen. Die Kapitelüberschrift doppelt sich zudem mit dem folgenden Kapitel „Vorbereitung auf den Tod“, hier sollten zur besseren Unterscheidung die Überschriften inhaltlich noch spezifiziert werden.
Schwanfelder gibt hier zudem einen Leitfaden zur Erstellung einer „Lebensbilanz“ mit einer Vielzahl von konkreten Fragen – wiederrum einer der interaktiven Anteile des Buches, denn die Fragen sollen die Lesenden durchaus auch für sich beantworten. Es folgt eine Anleitung zur Bestandsaufnahme des eigenen Lebens mit konkreten Impulsen, um das Leben einmal von Grund auf aufzuräumen – gedanklich und praktisch. Insgesamt gibt besonders dieses Kapitel so viele neue Anreize zum Pläne schmieden und Leben umkrempeln, dass „zum Sterben keine Zeit mehr bleibt.“ Es macht einfach Lust auf Leben!
Vorbereitung auf den Tod
Der „Vorsorgeordner“ mit äußerst umfangreicher und konkreter Checkliste, Einführung zur Vorsorgevollmacht, Dokumente zum Todesfall, Erbschaft und Erbvertrag oder Testament – kurzum: eine beeindruckende, vollumfängliche Informationssammlung zum bürokratischen Sterben in Deutschland. Wer nach diesem Konvolut an bürokratischen Ratschlägen erst einmal geplättet ist, den muntert Schwanfelder meisterhaft mit zwei flotten Witzen zur Erbschaft wieder auf.
Die Bestattung
Beschreibt schlicht und nüchtern, was zwischen Tod und Bestattung geschieht, wie eine Trauerfeier abläuft, welche Bestattungsformen es gibt usw.: räumt so mit Unwissen auf und gibt Gewissheit über den Ablauf. Das kann sicher vielen Lesenden ein Trost sein, da es die Angst vor dem Ungewissen (in diesem Fall: dem Tod) nimmt. Mit der angefügten Checkliste wird Möglichkeit gegeben, die eigene Bestattung nach persönlichen Wünschen vorauszuplanen und so außerdem den Hinterbliebenen einige Arbeit abzunehmen (dieser Punkt bedient sicher eine große Nachfrage, da viele ältere Menschen sich sorgen, ihren Liebsten zur Last zu fallen – im Leben und darüber hinaus auch noch im Tod).
Unter „Besondere Bestattungsformen“ geht der Autor übersichtlich auf einige besondere kulturelle, religiöse und regionale Bestattungsformen weltweit ein – ein schöner Abschluss für dieses Überkapitel, da es (wie in einem anderen Kapitel die eingestreuten Witze) die Stimmung wieder hebt.
Die Bestattungsverfügung
Wieder mit Checkliste, außerdem Hinweis auf die Möglichkeit einer Organspende sowie die wichtigsten Infos und eine Checkliste dazu.
Patientenverfügung
Beleuchtet den Hintergrund und Sinn einer Patientenverfügung und enthält wieder die obligatorische Checkliste sowie alle Besonderheiten, an die gedacht werden muss. Außerdem konkrete Vorlagen einer Patientenverfügung, die gegebenenfalls 1 zu 1 (entsprechend nach persönlichen Krankheiten personalisiert natürlich) übernommen werden können. Die beispielhafte Patientenverfügung ist zudem bereits kursiv gesetzt und lässt sich somit hervorragend vom restlichen Fließtext unterscheiden.
Was bleibt von uns übrig?
Zur Abwechslung wieder ein paar lebensphilosophisch-metaphysische Überlegungen, sehr erfrischend und eine perfekte Ergänzung zu den vorangegangenen Ausführungen. Anrührend poetisch geschrieben und tolle Adaption der bereits in den anderen Kapiteln gängigen Checkliste: „Checkliste: Erinnerungen“ – diese soll helfen, den „inneren“ Nachlass zu regeln. Außerdem Überlegungen zum eigenen Vermächtnis, Checkliste zur Regelung des „digitalen Nachlass[es]“ und praktische Überlegungen zu persönlichen Dokumenten wie Tagebüchern etc., Stammbaum-Anleitung sowie Gedanken und Checkliste zum Entrümpeln materieller Habseligkeiten.
Abschließend nimmt Schwanfelder auch ausgefallene Methoden wie die Konservierung lebender Körper in den Blick, gibt einen Überblick über mögliche Optionen und geht auf die Kyrokonservierung etwas näher ein.
Über das Sterben
Beschreibt, woran man erkennt, dass sich der Körper auf das Ende vorbereitet und wann es Zeit ist, zu gehen. Am Rande einige Fakten zur historischen Sterbeentwicklung, Sterbebegleitung, Palliativmedizin und Hospizarbeit sowie das Recht auf selbstbestimmtes Sterben.
Schwanfelder hält in diesem Kapitel mit seinen eigenen Überlegungen vom Lebensende nicht hinterm Berg und spricht ganz offen darüber, dass er sich im Falle einer notwendigen Pflegebetreuung für sich selbst einen selbstbestimmten Tod wünscht. Etwas schwierig, da hier im interaktiven Teil explizit nach Suizidgedanken gefragt wird – evtl. noch einmal problematisieren, dass es hier ein wohlüberlegtes Auseinandersetzen mit einem selbstbestimmten Ende gefragt ist und es sich nicht um eine Aufforderung zum aktiven Suizid handelt. Der Autor weist zwar wiederholt darauf hin, dass bei Suizidgedanken unbedingt professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden sollte, aber es bleibt ein sehr problematisches Kapitel, da es zum Ende hin geradezu in eine Suizid-Anleitung ausartet!!
(Suizid durch Medikamentenintoxikation, „Wie kann man konkret vorgehen?“, Suizid
durch Inertgase)
Was kommt nach dem Sterben?
Schwanfelder führt hier seine Überlegungen zu Nahtoderfahrungen an, außerdem wird umfangreich auf die differenzierten Vorstellungen vom Jenseits in unterschiedlichen Religionen und antiken Kulturen eingegangen. Zwischendrin drei rührende Geschichten zu Wiedergeburt, Lebenszyklus und dem Existenzbewusstsein. Ein sehr interessantes, schönes Kapitel.
Nach dem Tod kommt das Begräbnis
Gibt Hilfestellungen für die Hinterbliebenen mit Informationen, Ratschlägen und Hinweisen zur Beerdigung, Todesanzeige, Trauerfeier, Nachruf, Trauerrede, Leichenschmaus. Allen Punkten beigefügt sind wieder Checklisten. Zu Todesanzeige und Trauerrede stellt der Autor sogar vorgefertigte, generische Texte zur Übernahme bereit, die ohne Weiteres übernommen werden können. Zum Abschluss porträtiert Schwanfelder noch länderspezifische Trauerbräuche rund um den Globus.
Das Weiterleben nach dem Tod
Dieses Kapitel räumt den Hinterbliebenen sehr einfühlsam das Recht auf Trauer ein und mutet fast an Therapie an. Sehr empathisch und hilfreich bei er Trauerbewältigung: es macht Mut, spendet Kraft und eröffnet einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Der Autor bleibt sich treu und entsprechend ist auch zur Trauerbewältigung eine Checkliste beigefügt.
Das Buch schließt mit einer Geschichte, die auf das Glück im Hier und Jetzt verweist. Sie lehrt, im Augenblick zu leben und sich nicht in Gedanken über Zukunft oder Vergangenheit zu verlieren. Ein toller Abschluss à la „carpe diem – memento mori“.
Sprache und Stil: meist kurze, knackige Sätze; trocken, präzise und klar aber trotzdem einfühlsam; teils selbstironisch und elegant humorvoll, teils poetisch und lebensphilosophisch
Fazit: Das gesellschaftlich schwere Thema Tod wird umfangreich aufbereitet und durch literarische Lebensweisheiten aufgelockert: Zitate (gut gewählt und inhaltlich top eingefügt!), Witze, Bibelzitate, Geschichten sind überall im Buch eingestreut und ergänzen die Fachrecherche zu Tod und Sterben hervorragend. Faktisch wird auf unzählige Eventualitäten (zum Thema Tod) eingegangen und die Auskünfte sind dabei so kleinteilig ausgeführt, dass kaum noch eine Frage offenbleiben kann.
Mit erfrischender Selbstironie wird dem Lesenden die Angst vor dem Ende genommen, ohne dabei pathetisch irgendetwas zu beschönigen. Der Ratgeber bietet Trost und Beruhigung; unterschwellige Botschaft, die häufig durchscheint: dem Tod mild und gemessen entgegenzublicken und ihn anzunehmen.
Schwanfelder gibt Anleitung zur Vorbereitung auf den letzten Lebensabschnitt mit diversen Checklisten und bezieht den Lesenden interaktiv mit ein, indem er in diesem personalisierbaren „Arbeitsbuch“ Platz für Annotationen, eigene Gedenken und Ideen bietet.
Es ist offensichtlich, dass Schwanfelder nicht zum ersten Mal einen Ratgeber schreibt, die Checklisten und Hintergrundinformationen sind äußerst umfangreich recherchiert und fundiert, die Aufforderungen zum interaktiven Mitwirken sind sinnvoll, präzise und im richtigen Maße auffordernd, ohne dabei aufdringlich zu sein.
Orthografisch und grammatikalisch ist auf den ersten Blick alles i. O., der Schreibstil ist sehr angenehm zu lesen und hat einen individuellen Charme. Insgesamt toll recherchiert und geschrieben, äußerst abwechslungs- und lehrreich; der Ratgeber regt zum Nachdenken an und bringt erstaunlich viel Leichtigkeit in dieses Thema, um das wir doch sonst eher einen Bogen machen.